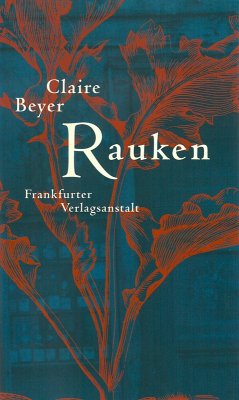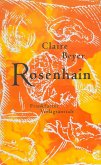Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Jenseits aller Hoffnung: Claire Beyers Roman "Rauken"
Von dem polnischen Schriftsteller Gustaw Herling stammt einer der ersten Berichte über die stalinistischen Straflager, "Welt ohne Erbarmen" (es wurde in diesem Herbst wiederaufgelegt). Darin schreibt er über die psychische Verfassung des GULag-Häftlings: "Der Gefangene kann das Leben im Lager nur ertragen, wenn er alle Kriterien, die er in der Freiheit angewandt, aus seinem Gedächtnis und Herzen zu verbannen vermag." So ist es unsinnig, auf Entlassung zu hoffen, nur weil die Haftzeit zu Ende geht; kann sie doch im letzten Augenblick und grundlos mit einem willkürlichen Federstrich um viele Jahre verlängert werden. Besser also, nicht zu hoffen.
Die sechsjährige Vroni kennt die Freiheit nicht, kommt also auch nicht in Versuchung, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben. Ihr Lager ist die Familie, eine freudlose Zwingburg im dörflichen Bayern der frühen fünfziger Jahre, in der Gewalt und Willkür herrschen. Lagerkommandant ist der Großvater, in Personalunion Bäcker, Metzger und Bürgermeister des Ortes; ihm sind alle Familienmitglieder und Dienstboten gleichermaßen und offensichtlich ohne Abstufungen untertan. Gewissermaßen der Kapo des Familien-GULags ist Vronis Vater, ein invalider Kriegsheimkehrer, versehrt an Körper und Seele, als nutzloser Kostgänger auf dem Hof nur geduldet, der seine demütigende Situation in Wut- und Gewaltausbrüche gegen die ihm Ausgelieferten umsetzt: seine Frau, seine Kinder, besonders Vroni.
"Wenn sein Atem nach Bier riecht, wird er zuschlagen", weiß das Mädchen. Es hat gelernt, die Schläge still hinzunehmen, denn Weinen oder Schreien verstärken des Vaters Brutalität nur noch. Einen Grund zu prügeln braucht er nicht - er schafft ihn selbst. "Er schlägt nach ihr, weil es nach Plastik riecht, weil sie weint, weil er im Wirtshaus Ärger hatte, weil sie ihn ansieht mit seinen Augen." Sie ekelt sich vor Fleisch, will es nicht essen, "aber Vaters Peitsche war stärker. Er zählte die Bissen Fleisch ab, die sie essen mußte. Ein Hieb für jeden Bissen."
Wenn ihm das Essen nicht schmeckt, das die Tochter kochen muß (ohne es je gelernt zu haben), tobt er los: "So ein Fraß! Schon klebt alles an der Wand, liegt am Boden, übel wird ihr, wenn er ihr Gesicht in das Gemisch der Reste drückt." Als er einen Aschenbecher zerschmeißt, soll sie die Scherben zusammenkehren; als das nicht schnell genug geht, tritt er nach ihr, "packt sie am Arm, wirft sie auf den Rücken. Die tiefe Schnittwunde wird zu einem Halbmond." Die Lakonie und die Selbstverständlichkeit, mit der diese Sätze den täglichen Terror hinnehmen, sind schwer auszuhalten.
Einmal, da hat er sie an den Haaren die Treppenstufen hochgeschleift und fallen gelassen, kommt sie mit offenem Bruch und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Einige Wochen liegt sie da, hält den Arm vor dem Gesicht, um nichts zu sehen. Ein einziges Mal nur kommt die Mutter zu Besuch "mit einem Gesicht voller Vorwürfe". Nie versucht die Mutter, die Tochter vor den mörderischen Schlägen zu schützen. Sie zieht sich in ihr Zimmer zurück, verweigert Vroni den Zutritt, öffnet den Gashahn, wird gerettet, landet schließlich für lange Monate in der Psychiatrie - die man damals noch Irrenhaus nannte. Eine "Schande", die wieder auf die Tochter zurückfällt; sie wird in der Schule geächtet.
Schuld tragen müssen für nicht begangene Verfehlungen, einzig für ihr Dasein: Das ist die "Strafe", die Vroni im häuslichen Lager verbüßen muß. Daß sie zur Welt kam, zu dieser Welt ohne Erbarmen, kettet den Vater an die Mutter; aus ihrem Gesicht blickt der Mutter der Vater entgegen, das erträgt diese wiederum nicht, das macht sie unfähig zur kleinsten zärtlichen Geste.
Näher als der Mutter kommt Vroni Ivan, einem russischen Kriegsgefangenen, der "irgendwie geblieben ist nach Kriegsende"; aber er wird vom Hof gewiesen; oder Pierre, der bucklige Sohn eines heimgekehrten jüdischen Fabrikbesitzers, der Mozart auf dem Klavier spielt und träumt, Mozart zu sein; aber die Familie wird aus dem Dorf vertrieben, Vroni träumt ihr lange hinterher. Einen altersschwachen Hund, mit dem sie sich angefreundet hat, schmettert der Vater eines Tages gegen die Zimmerdecke. "Nur einen Ton", herrscht er die Tochter an, die vor Entsetzen losschreien will, "und dir geschieht das Gleiche."
Nach einem schlimmen Exzeß wird der Vater eine Weile entfernt, wird Vroni von einem freundlich-rundlichen Onkel beherbergt, macht die Mutter einen neuen Anlauf mit einem Ladengeschäft; aber das ist nur ein kurzes Atemholen; es läßt Vroni den Hauch eines anderen Lebens spüren, eines Lebens, das diesen Namen überhaupt verdient. Aber dieser Hauch verfliegt schnell. "Immer häufiger kam der Vater. Dann erstarb das Leben."
Gustaw Herling hebt die durch Leid, Druck und die Einschränkung des Gesichtsfeldes ungeheuer geschärfte Beobachtungsgabe des Lagerhäftlings hervor. Diese überlebenswichtige Gabe hat sich auch Vroni erworben. Sie erkennt, an kleinsten Anzeichen, wann wieder ein Gewaltausbruch bevorsteht. Sie spürt an den Farben, am Geruch eines der vielen Häuser, die die Familie nacheinander bewohnt, wie es ihr dort ergehen wird. In einer Wirtsstube stehen Stühle auf dem Kopf, "recken drohend die Beine nach oben".
Die seelische Bedrängnis überträgt sich auf die Dinge: Das gestaltet Claire Beyer behutsam und ohne spürbare Kunstanstrengung. Begründet, eingeordnet, psychologisiert wird in "Rauken" nur so weit, wie es die erschöpften und drangsalierten Menschen in Vronis Umgebung selbst tun. Von einem "Splitter im Kopf" des Vaters ist entschuldigend die Rede. Davon, daß der Krieg "auch die umbringt, die er nicht tötet". Oder von der Landschaft, vom armen Allgäu, dem "alten, gebeutelten Land", das die Menschen hat hart werden läßt, "hart wie der Fels".
Claire Beyer, die mit diesem späten Debüt - die Autorin ist Jahrgang 1947 und arbeitet als Bankkauffrau - einen bis auf ein paar kitschverdächtige Passagen nahezu makellosen Text vorgelegt hat, beschränkt den Blickwinkel ganz auf das Erleben ihrer Protagonistin, die am Anfang der Erzählung sechs, am Ende dreizehn Jahre alt ist. Es ist der deformierte Blick des Häftlings, der nur das wahrnimmt, was zur Abwehr unmittelbarer Bedrohung notwendig ist. Der, wie Herling sagt, dafür alle Kategorien von Freiheit vergessen hat.
Dennoch ist es für den Leser leicht, den Blick über diesen, in seiner Drastik vielleicht extremen, in der Struktur aber durchaus exemplarischen Einzelfall hinaus zu weiten: auf eine Generation, die die Erfahrung von NS-Diktatur und Weltkrieg nicht verarbeitet, sondern nur verdrängt hat, und damit die eigenen Deformationen an die nächste weitergab. Doch ist diese soziologische Interpretation weniger interessant als die subjektive Erlebniswelt eines Kindes, über dessen Eintritt ins Leben das dantesche Höllenmotto "Lasciate ogni speranza" gestanden haben muß.
MARTIN EBEL
Claire Beyer: "Rauken". Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2000. 128 S., geb., 29,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH