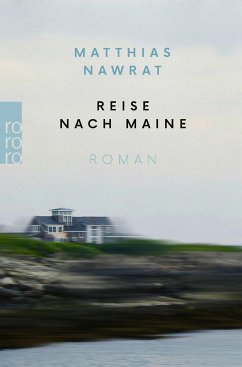Ein Mann - er ist Schriftsteller von Beruf, nachdenklich und ein wenig konfliktscheu - will die USA bereisen. Zunächst nach New York City, dann weiter Richtung Maine. An seiner Seite eine meinungsstarke Osteuropäerin, die seit dreißig Jahren im Fränkischen zu Hause ist: seine Mutter. Von Beginn an liegt ein Schatten auf der Unternehmung: Donald Trump ist seit kurzem Präsident der angeschlagenen Nation, und Celina hat ihrem Sohn kurz vor der Abreise eröffnet, dass sie, anstatt die zweite Reisewoche bei einem Jugendfreund in Texas zu verbringen, die ganze Zeit mit ihm zusammenbleiben wird. Dann hat sie auch noch einen Unfall. Mit gebrochener Nase und zwei blauschwarzen Veilchen zieht sie überall die Aufmerksamkeit wohlmeinender Fremder auf sich. Der leise Ärger des Sohnes wird zunächst von Sorge überlagert. Auf der Autoreise an die Küste Neuenglands aber beginnt ein Konflikt aufzubrechen, der viel darüber verrät, wie Männer mit Frauen, wie Mütter mit Söhnen sprechen, ein Konflikt, der nicht nur das Leben der beiden und ihr Verhältnis zueinander prägt. Davon erzählt Matthias Nawrat in sehr komischen, fein austarierten Szenen. Immer im Hintergrund: America the beautiful, der derangierte Sehnsuchtsort.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.