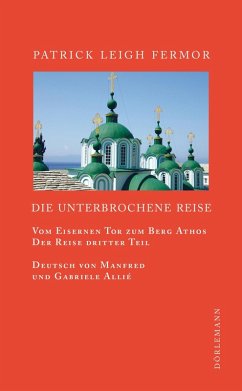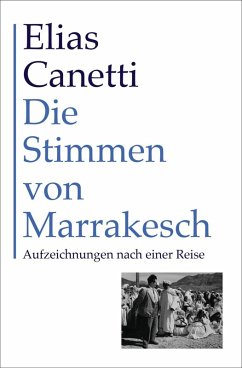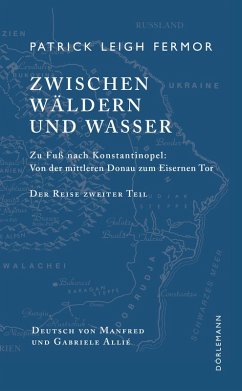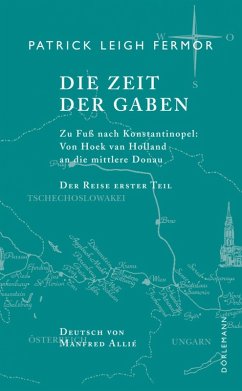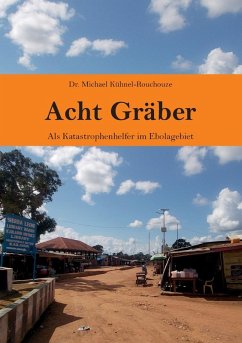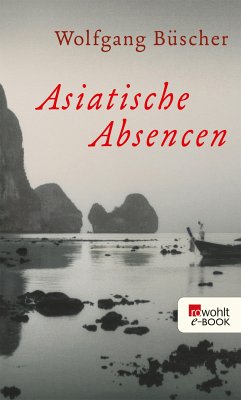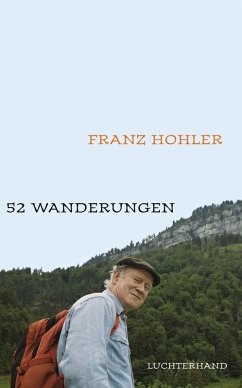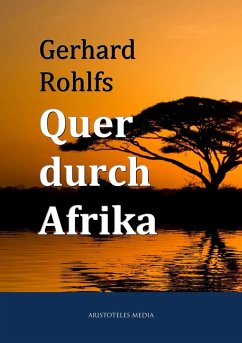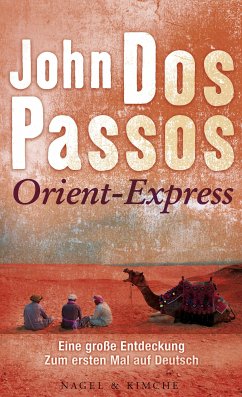Reise ohne Landkarten (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
14,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im Januar 1935 reiste Graham Greene von Liverpool aus nach Westafrika, um auf dem Fußweg Liberia zu durchqueren. Europa hatte er nie zuvor verlassen, und er gab unumwunden zu, ein absoluter Amateur in Sachen Reisen zu sein. Er hielt es für das Beste, im benachbarten Sierra Leone Träger und Führer anzuheuern, mit dem Zug bis zum Ende der Eisenbahnlinie in Pendembu zu reisen und von dort zur liberianischen Grenze zu marschieren. Aber schon als es gilt, die genaue Route festzulegen, gibt es Probleme. Greene kann nur zwei Landkarten auftreiben, auf denen Liberia überhaupt verzeichnet ist. Auf...
Im Januar 1935 reiste Graham Greene von Liverpool aus nach Westafrika, um auf dem Fußweg Liberia zu durchqueren. Europa hatte er nie zuvor verlassen, und er gab unumwunden zu, ein absoluter Amateur in Sachen Reisen zu sein. Er hielt es für das Beste, im benachbarten Sierra Leone Träger und Führer anzuheuern, mit dem Zug bis zum Ende der Eisenbahnlinie in Pendembu zu reisen und von dort zur liberianischen Grenze zu marschieren. Aber schon als es gilt, die genaue Route festzulegen, gibt es Probleme. Greene kann nur zwei Landkarten auftreiben, auf denen Liberia überhaupt verzeichnet ist. Auf der einen Karte, angefertigt vom britischen Generalstab, findet sich anstelle von Liberia ein großer weißer Fleck. Die andere Karte wurde vom Kriegsministerium der Vereinigten Staaten herausgegeben. Dort, wo die englische Karte sich damit begnügt, einen Fleck zu zeigen, steht bei den Amerikanern in fetten Buchstaben das Wort "Kannibalen" ... Graham Greenes Bericht über seinen legendären Fußmarsch ins Herz der Finsternis liegt nun erstmals vollständig auf Deutsch vor. "Reise ohne Landkarten" ist das Porträt eines Landes jenseits aller Zivilisation und die faszinierende Geschichte eines Mannes auf der Suche nach sich selbst.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deAls der englische Schriftsteller Graham Greene Anfang 1935 in Freetown landet, zeigen sich die Amtsträger so verdächtig hilfsbereit, dass er beschließt, die vom Innenminister vorgeschlagene Route durch Liberia zu meiden. Erleichtert wird ihm dies, weil er lediglich zwei Landkarten der Republik auftreiben kann. Eine zeigt einen weißen Fleck, auf dem gepunktete Linien den vermutlichen Lauf einiger Flüsse darstellen - wie sich später herausstellt allerdings so falsch wie die Ortsnamen. Die andere Karte hat den Fleck um den fett gedruckten Hinweis "Kannibalen" bereichert. Immerhin weiß Greene aus dem Blaubuch der britischen Regierung, dass dort Massaker an Dorfbewohnern an der Tagesordnung sind und Krankheiten wie Elefantiasis, Lepra, Frambösie, Malaria ebenfalls. Immerhin böten Holz- und Wellblechhütten "geeignete Zufluchten" vor der "wimmelnden" Rattenpopulation. Man kann es deshalb nur als Wunder bezeichnen, dass Greene dieses Buch überhaupt hat schreiben können. Ohne dieses Meisterstück an ironisch-komischem britischem Understatement aber wäre die Reiseliteratur ärmer. Mit Michael Kleebergs gelungener Übersetzung des im Original 1936 erschienenen Buchs beweist der Liebeskind Verlag wieder einmal seinen Sinn für verborgene literarische Schätze.
buecher-magazin.deAls der englische Schriftsteller Graham Greene Anfang 1935 in Freetown landet, zeigen sich die Amtsträger so verdächtig hilfsbereit, dass er beschließt, die vom Innenminister vorgeschlagene Route durch Liberia zu meiden. Erleichtert wird ihm dies, weil er lediglich zwei Landkarten der Republik auftreiben kann. Eine zeigt einen weißen Fleck, auf dem gepunktete Linien den vermutlichen Lauf einiger Flüsse darstellen - wie sich später herausstellt allerdings so falsch wie die Ortsnamen. Die andere Karte hat den Fleck um den fett gedruckten Hinweis "Kannibalen" bereichert. Immerhin weiß Greene aus dem Blaubuch der britischen Regierung, dass dort Massaker an Dorfbewohnern an der Tagesordnung sind und Krankheiten wie Elefantiasis, Lepra, Frambösie, Malaria ebenfalls. Immerhin böten Holz- und Wellblechhütten "geeignete Zufluchten" vor der "wimmelnden" Rattenpopulation. Man kann es deshalb nur als Wunder bezeichnen, dass Greene dieses Buch überhaupt hat schreiben können. Ohne dieses Meisterstück an ironisch-komischem britischem Understatement aber wäre die Reiseliteratur ärmer. Mit Michael Kleebergs gelungener Übersetzung des im Original 1936 erschienenen Buchs beweist der Liebeskind Verlag wieder einmal seinen Sinn für verborgene literarische Schätze.