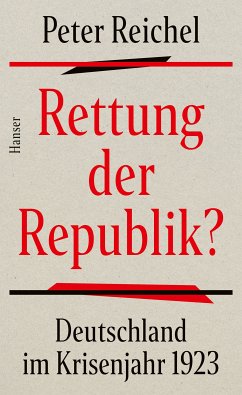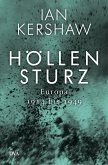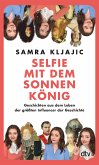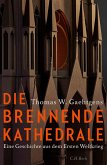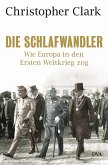Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.

Ruhrbesetzung, Hitler-Putsch, linke Umsturzpläne, nationalkonservative Attacken, Hyperinflation: Die Weimarer Republik überstand 1923 einige Gefahren. Fünf neue Bücher widmen sich diesem Jahr.
Dass Bonn nicht Weimar sei, gehörte zu den unumstößlichen Glaubenssätzen der jungen Bundesrepublik. Je länger sie bestand und an politischer Reife gewann, desto mehr verflüchtigte sich dieses Credo. Die zunehmend stabile und selbstbewusste zweite deutsche Demokratie benötigte nicht mehr den Abgleich mit der früheren gescheiterten Republik als Negativfolie. "Weimar" als mahnende Gegenwartsformel verlor kontinuierlich an Bedeutung, bis sich in einer Zeit neuer Krisen ab etwa 2008 eine Trendumkehr ankündigte. Seither ist das Interesse an ins Wanken geratenen Demokratien deutlich gewachsen und die Rede von "Weimarer Verhältnissen" wieder häufiger zu vernehmen.
Vor dem Hintergrund der nicht abreißenden Krisen unserer Gegenwart dürften Publikationen über das spannungsgeladene Jahr 1923 von besonderem Interesse sein. Eine Reihe von Darstellungen ist rechtzeitig zum Zentenarium erschienen. Den Auftakt machten der Band "Im Rausch des Aufruhrs", in dem der Journalist Christian Bommarius Szenen eines Jahres kaleidoskopartig sichtete (F.A.Z. vom 22. März), sowie die Betrachtungen des Dubliner Zeithistorikers Mark Jones über ein paradoxerweise zugleich traumatisches wie demokratiestärkendes Jahr für die Deutschen (F.A.Z. vom 25. Juni). Nun liegen fünf weitere Darstellungen vor, die mit dem Blick auf 1923 die komplizierte politische, gesellschaftliche und kulturelle Lage der Weimarer Republik zwischen früher Revolutionszeit und dem relativ stabilen Jahrfünft ab 1924 nachvollziehbar machen wollen.
Die Bücher fügen sich in den Trend, anhand eines besonders geschichtsträchtigen Jahres gleichsam eine gesamte Epoche einzufangen zu suchen. Wie lang die Mode dieser Jahresschriften noch anhalten wird, ist nicht ausgemacht; mit "1923" bekommt sie aber nochmals Auftrieb, der zumindest bis zum Jahrestag des Hitler-Putsches in München im November 2023 andauern dürfte.
Dieses wohl berühmteste Ereignis jenes Jahres, wie es sich am 8./9. November zutrug, lässt sich wie ein historisches Kammerspiel erzählen, das Komik mit Tragik verbindet. Selbst wenn es schwerfällt, es im Rückblick als Posse abzutun. Zeitgenössische Kommentatoren, ob in der "Frankfurter Zeitung" oder der "New York Times", prophezeiten damals nach dem missglückten Griff nach der Macht vorschnell ein Ende von Hitlers politischer Karriere.
Gerade aufgrund dieser Fehleinschätzungen ist es wichtig, an zeitgenössische Wahrnehmungswelten und Urteile zu erinnern. Zumal schon die Mitlebenden spürten, wie außergewöhnlich dieses Jahr war. Stefan Zweig sprach in seiner Autobiographie von einer "Tollhauszeit" und Sebastian Haffner in seiner "Geschichte eines Deutschen" regelrecht konsterniert von einem "unmöglichen Jahr". Der Herausforderungen und turbulenten Ereignisse, wie sie gleich im Januar 1923 einsetzten, waren in der Tat viele. Ruhrbesetzung und -kampf stehen am Anfang der Chronologie und sorgten für eine Welle nationaler Empörung und Geschlossenheit. Die militärisch ohnmächtige Reichsregierung rief die Bevölkerung (insbesondere Kohlearbeiter und Eisenbahner) zu "passivem Widerstand" auf. Um den Lohnausfall zu kompensieren, warf sie die Gelddruckmaschinen an und steigerte die damit verbundene, schon fast ein Jahrzehnt andauernde Entwertung des Papiergeldes bis hin zur Hyperinflation.
Diese Vorgänge nehmen in allen Darstellungen zu Recht großen Raum ein, weil sie die gesamte Bevölkerung betrafen und abgesehen von einigen "Inflationsgewinnlern" vor allem schwer Geschädigte hervorbrachten. Mit der Inflation ging ein schwerwiegender Vertrauensverlust einher, der den Deutschen fortan in den Knochen steckte. Die massive Verunsicherung, verbunden mit einem neu auflodernden Nationalismus, begünstigte im Herbst 1923 eine Reihe von Bestrebungen, die auf eine Rechtsdiktatur zielten. Daneben suchten die Kommunisten, von Sachsen und Thüringen ausgehend einen roten "Deutschen Oktober" in Gang zu setzen. Dass diese Umsturzpläne ebenso wie separatistische Unterfangen im Rheinland misslangen, lag an manch glücklicher Fügung, vor allem aber auch am entschlossenen Handeln republikanischer Politiker - an vorderster Stelle Reichskanzler Gustav Stresemann und Reichspräsident Friedrich Ebert.
Volker Ullrich notiert für den Hunderttagekanzler Stresemann eine positive Leistungsbilanz, die er in einer entschlossenen Verteidigung von Verfassungsordnung und Parlamentarismus, in der Eindämmung der Hyperinflation mit der Einführung der "Rentenmark" und vielversprechenden Lösungsversuchen des Reparationsproblems erkennt. Die anderen Autoren sehen das ähnlich. Am kritischsten beurteilt Peter Longerich Stresemanns Krisenmanagement, das - wie das Jahr 1923 insgesamt - von erheblichen Kontrollverlusten gekennzeichnet gewesen sei. Wenn die Weimarer Demokratie damals noch nicht an ihr Ende gelangte, lag das für ihn weniger an staatsmännischem Geschick als an der mangelnden Geschlossenheit zwischen rechtsextremistischem und nationalkonservativem Lager zu diesem Zeitpunkt.
Insgesamt prägen die fünf Darstellungen aber kaum kontroverse Sichtweisen. Dabei unterscheiden sie sich in der Anlage stark voneinander. Ullrich hat so solide wie souverän den neuesten Wissensstand zu 1923 eingefangen, und Vergleichbares trifft auf Longerichs Buch zu. Wer nach einer umfassenden, verständlichen, entlang der multiplen Krisenmomente sinnvoll gegliederten und gut lesbaren Gesamtdarstellung sucht, wird in beiden Fällen bestens bedient. Nicht nur klar strukturiert, sondern auch lebendig und anschaulich ist insbesondere Ullrichs Darstellung, weil in ihr wohldosiert die Stimmen aufmerksamer Zeitzeugen zu vernehmen sind. Die Liste seiner Kronzeugen reicht von Thomas Mann und Hedwig Pringsheim über Victor Klemperer und Thea Sternheim bis zu Harry Graf Kessler und Sebastian Haffner. Hinzu kommt die Auswertung vieler Zeitschriften und Zeitungen, wodurch unterschiedliche Sichtweisen zur Geltung kommen.
Abgerundet wird Ullrichs Buch durch ein Kapitel zur kulturellen Szenerie, mit dessen Hilfe der Autor nochmals den Charakter einer janusköpfigen Zeit hervorhebt: Fundamentaler Vertrauenslust und fulminante Vergnügungssucht erschienen wie zwei Seiten einer Medaille. Diese Doppelgesichtigkeit ist auch aus den Büchern von Jutta Hoffritz und Peter Süß herauszulesen. Eine Geschichtsdarstellung im klassischen Sinne bieten sie allerdings nicht, vielmehr so etwas wie die retrospektive Inszenierung eines außergewöhnlichen Jahres, das sie Monat für Monat abhandeln. Die Journalistin Hoffritz lässt Akteure wie die Nackttänzerin Anita Berber und den Großindustriellen Hugo Stinnes, die Bildhauerin Käthe Kollwitz oder den Notenbankchef Rudolf Havenstein neben vielen anderen wiederholt auftreten. Das Kurzatmige der Zeit spiegelt sich in kurzen Absätzen wider, die häufig nur aus ein oder zwei knappen Sätzen bestehen.
Peter Süß, im Hauptberuf Filmschaffender, lässt hingegen größere szenische Blöcke geschickt geschnitten aufeinanderfolgen. Das ist temporeich und fängt in impressionistischer Weise wechselnde Zeitstimmungen gut ein. Anstelle einer historischen Erzählung oder Analyse eröffnet er so etwas wie den Blick in ein multiperspektivisches Tagebuch. Das von Hoffritz und Süß gepflegte historische Präsens soll ganz nah an die Vergangenheit heranführen. So unmittelbar und unterhaltsam das wirkt, geschieht diese Fokussierung doch bisweilen auf Kosten eines differenzierten und distanzierten historischen Urteils.
Peter Reichel hingegen sucht aus der Vogelperspektive mehr Ordnung in die Vorgänge zu bringen. Sein Buch beansprucht keine Vollständigkeit und will Konturen des Jahres 1923 mittels dreier Schwerpunkte angemessen deutlich machen. Der historisch geschulte Politikwissenschaftler skizziert zunächst Gefahren von außen, bevor er sich jenen von innen zuwendet und anschließend republikanische Rettungsversuche würdigt. Ein Ausblick wirft Schlaglichter bis ins Jahr 1925, als die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten eine deutliche Zäsur markierte. Es gab Alternativen, mit deren Hilfe sich stärker an die republikanische Ebert-Periode hätte anknüpfen lassen können, das betont Reichel fast ein wenig verärgert über eine zu geringe politische Reife der Wähler.
In seiner politikgeschichtlichen Betrachtung schärft er die Aufmerksamkeit für solche Wegmarken, stellt kontingente Momente ebenso wie jene eines fehlgeleiteten politischen Handelns heraus. So klar er rechtsextreme und nationalkonservative Attacken auf die Republik geißelt, kritisiert Reichel das Agieren einer radikalen Linken gegen das parlamentarisch-demokratische Verfassungswerk von 1918/19 doch besonders scharf. In den Kommunisten erkennt er die eigentlichen "Gegenrevolutionäre", aber auch kompromisslos antibürgerliche Kräfte in der SPD oder linkssozialistische Intellektuelle, die den Wert der konstitutionellen Revolution nach dem Ersten Weltkrieg gering schätzten, bekommen ihr Fett ab. Übertrieben wirkt Reichels Furor gegen Kurt Eisner, dem er gemeinsam mit weiteren Rätekämpfern die Verantwortung dafür zuschiebt, dass München erst zur rechtsradikalen "Ordnungszelle" werden konnte. Abgesehen von diesem übermäßig ausladenden Rekurs auf die bayerischen Verhältnisse 1919 hat Reichel eine lesenswerte Studie zur Staats- und Demokratiekrise der jungen Republik vorgelegt, die eine "Stunde der Hasardeure", aber auch der "integren Staatsmänner" erlebte.
Wie man es auch dreht und wendet, 1923 war kein eindeutiges Jahr. Momente der Demokratierettung und nationalen Rekonvaleszenz lassen sich ebenso konstatieren wie Ursprungsszenen eines mentalitätsgeschichtlich höchst gefährlichen Inflationstraumas und Vorboten der späteren Diktatur. Die Weimarer Republik erwies sich als erstaunlich resilient, ohne daraus dauerhafte Stabilität schöpfen zu können. Für Longerich litt die Weimarer Republik in den Folgejahren sogar unter einer gefährlichen "Stabilitätsillusion", da "strukturelle Grundprobleme" nur eingedämmt, aber nicht behoben worden seien. ALEXANDER GALLUS
Volker Ullrich: "Deutschland 1923". Das Jahr am Abgrund.
C.H. Beck Verlag, München 2022. 441 S., Abb., geb., 28,- Euro.
Jutta Hoffritz: "Totentanz". 1923 und seine Folgen.
HarperCollins Verlag, Hamburg 2022. 336 S., geb., 23,- Euro.
Peter Süß: "1923". Endstation. Alles einsteigen!.
Berenberg Verlag, Berlin 2022. 368 S., Abb., geb., 28,- Euro.
Peter Longerich: "Außer Kontrolle. Deutschland 1923.
Molden Verlag, Wien/Graz 2022. 320 S., geb., 33,- Euro.
Peter Reichel: "Rettung der Republik?". Deutschland im Krisenjahr 1923.
Hanser Verlag, München 2022. 288 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH