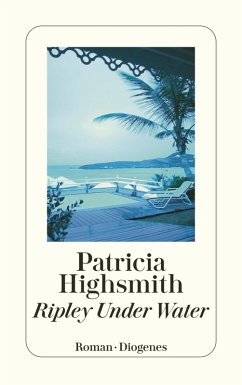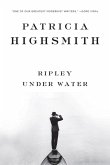Der Amerikaner Tom Ripley liebt tadellose Manieren, den richtigen Burgunder zum Hummer und allmorgendlich die schönste Blume aus dem liebevoll gehegten Garten seines Landsitzes südlich von Paris. Niemand käme auf die Idee, im Keller eines solchen Herrn nach Blutspuren zu suchen. Niemand außer Ripleys neuem Nachbarn, der davon träumt, Tom Ripleys Leben zu führen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.