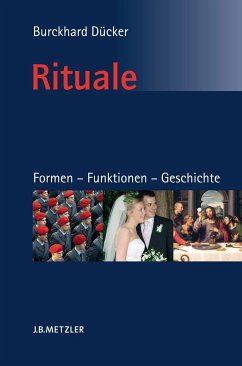Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Jedes Verfahren hat seine rituellen Aspekte und kann in Bezug auf sie kritisiert werden. Das gilt auch für Prüfungen und für Evaluationen an Hochschulen. Eine kleine Literaturschau.
Rituale haben traditionell einen schlechten Ruf. Sie gelten als dysfunktional und inhaltsleer. Wie Symbole und Zeremonien werden sie vorzugsweise archaischen oder jedenfalls vormodernen Gesellschaften zugeschrieben, während wir selbst uns souverän darüber erhoben haben: Rationalisierung bedeutet Entzauberung des Rituellen. Was an Ritualen fortbesteht, gilt dann als Überbleibsel ferner Zeiten.
Dieses gängige Vorurteil der Moderne haben diverse Wissenschaften mittlerweile selbst entzaubert. Eine neuere ritualwissenschaftliche Studie des Heidelberger Germanisten Burckhard Dücker strebt sogar umgekehrt an, Ritualen eine "Symbolrationalität" zuzusprechen. Ihr Zweck ist letztlich Ordnungsgestaltung und Gesellschaftsintegration. Umso erstaunlicher ist darum, was immer noch dabei herauskommt, wenn man Wissenschaftler nach den Ritualen universitärer Prüfungen und Evaluationen fragt. Der Jurist Ralf Oberndörfer polemisierte zuletzt in einem Aufsatz gegen die mündliche Prüfung im Ersten Juristischen Staatsexamen als Initiationsritual. Er greift dabei den Gedanken Michel Foucaults über die Prüfung in "Disziplinaranstalten" auf. In diesem Ritual verknüpfen sich, so Foucault in "Überwachen und Strafen", "das Zeremoniell der Macht und die Formalität des Experiments, die Entfaltung der Stärke und die Ermittlung der Wahrheit".
Bei Oberndörfer wird die erste juristische Staatsprüfung umstandslos unter diese Machtkritik subsumiert. Der Autor behauptet schlankweg, in der mündlichen Prüfung werde nichts verlangt, was von beruflicher Relevanz sei. Seine Argumente stützen sich auf die im Disziplinenvergleich überdurchschnittlich hohe Durchfallquote, den besonderen Formalisierungsgrad und die aus alledem resultierende Prüfungspanik der Rechtskandidaten. Die daraus abgeleitete Sozialisierungsfunktion wird durch Oberndörfer auf die Anklage verdichtet: "Im Zweiten Examen sollen Juristen zu Volljuristen werden. In der mündlichen Prüfung des Ersten Examens werden aus Menschen Juristen gemacht."
Diese polemischen Zuspitzungen bedürften freilich einer Anschauung, die sich auf mehr als Suggestionen stützt. Hier aber bleibt Oberndörfer Beweise schuldig und ruht sich auf Vorwürfen aus, die nicht einmal speziell auf juristische Abschlussprüfungen zugeschnitten sind. Denn mit gleichem Recht könnte man auch den Praxisbezug etwa medizinischer Staatsexamen oder der Lehrerausbildung diskutieren. Dabei müsste man überlegen, ob die von Oberndörfer angegriffenen Charakteristika des juristischen Staatsexamens nicht doch etwas mit berufsrelevanten Eigenschaften zu tun haben könnten. Denn in seinem mündlichen Teil zählen auch Wortgewandtheit, Konzentrationsvermögen und vor allem Kreativität im Umgang mit Halb- und Unwissen, die noch jeder Jurist gut gebrauchen kann.
Origineller und präziser ist das Buch von Christine Schwarz, eine Hannoveraner Dissertation, die sich der Evaluation als modernem Ritual widmet. Die Evaluatoren treten, wie auch die aktuelle Studie der französischen Soziologin Sandrine Garcia zeigt, als eine neue Expertengruppe auf. Unter dem Banner eines ökonomischen Verständnisses der Universität führen sie neue Modelle der Regulierung ein und werden dabei selbst zu Normproduzenten. Dabei gerieren sie sich als autonome, wissenschaftlich legitimierte und institutionell notwendige "Spezialisten" für die Qualität der Hochschulen in Forschung und Lehre, scheuen sich aber, als Entscheider aufzutreten.
Schwarz führte Forschungen an Forschern und Evaluatoren durch, um die rituellen Elemente dieses zwischen Hochschule, Verwaltung und Politik ablaufenden Prozesses zu identifizieren. Die Erforschten fanden das offenbar zumeist interessant, vielfach fühlten sie sich aber auch selbst evaluiert und damit kontrolliert. In ihrem glänzend geschriebenen Werk legt Schwarz viele Facetten eines Wissenschaftsbetriebes offen, der sich zunehmend auf permanente Nutzenbewertungen einstellen muss und die Begleiterscheinungen mit Humor, Langmut und Resignation hinnimmt.
Hinter der scheinbaren Gelassenheit verbergen sich aber auch Irritationen und Kritik an Zeitverschwendung, die mit der permanenten Selbst- und Fremdbeobachtung einhergehen. Die Evaluationsforschung wiederum führt dies in strukturierte Bahnen und bilanziert die Bilanzen. Die Evaluation wird dabei vielfach als Teil einer umfassenden Rationalisierung der Universität ausgegeben: Sie prüft das Althergebrachte und verwirft das Untaugliche. Ihre normierenden Verfahren werden unter dem nüchternen Banner der Zweckrationalität und Emanzipation implementiert.
Schwarz liest die Evaluationen hingegen gewissermaßen gegen den Strich: Sie fragt nach dem Rituellen in diesen Verfahren. Damit will sie den Ambivalenzen der Evaluation auf die Spur kommen, die in ihren Augen ebenso Herrschafts- wie Befreiungsinstrument ist. Ihre empirischen Befunde stützt sie unter anderem auf die Untersuchung der Evaluation von E-Learning-Projekten, wobei die besonderen Highlights für den Leser in den Selbstauskünften von Evaluierten, Evaluatoren und den diversen Wissenschaftsverwaltungen liegen.
So bekundete etwa ein Ministerialbeamter eine verblüffende Unkenntnis der Ergebnisse der Evaluation, die Schwarz als deren paradoxes Resultat deutet: Die Evaluation ermögliche und verstelle zugleich den administrativen Blick auf die handelnden Einzelnen und das zu evaluierende Ganze. Die Rationalisierungsansprüche schlugen sich dabei vorzugsweise in der Übernahme eines Management-Vokabulars technischer oder ökonomischer Prägung nieder. Damit verbinde sich stets die Forderung nach mehr Nutzen und Flexibilisierung. Sie werde von einer übrigens traditionell für ihre Unbeweglichkeit gescholtenen Institution (dem Ministerium) erzieherisch an die Erziehungsinstitution (die Universität) herangetragen.
Weitgehend einig waren sich die Befragten interessanterweise in ihrer Zurückweisung der Frage der Forscherin, ob die Evaluation auch rituelle Elemente enthalte. Sie empfanden dies teils als Irritation, teils als Provokation - dafür sei die Arbeit doch zu wichtig, als dass sie mit einem Begriff magisch-religiöser Prägung abzutun wäre: Der Ritualverdacht wurde vielfach rein negativ gelesen und von sich gewiesen. Das ist konsequent, denn auch Ritualforscher Dücker zeigt, dass Rituale für die Betroffenen oft und mit gutem Grund nicht als solche erkennbar sind. Der universitäre Kosmos kommt in Dückers Kompendium dennoch nur am Rande vor, die Hochschule selbst ist für den hochgeschulten Ritualforscher kein Musterbeispiel.
Schwarz ist in ihren Einschätzungen der Evaluationsrituale moderat und verweist darauf, dass es hier konkret darum gehe, Konformität in bürgerlichen Gesellschaften herzustellen. Evaluation sei "ein Gruppenhandeln, welches der Verständigung über kollektive Meinungsbilder und Bewusstseinsformationen dient". Insofern sei sie eine säkulare Form des Rituals. Zugleich komme dieses auch in seiner modernen, verwissenschaftlichten Variante nicht ohne das Moment der Nichtaufklärung aus: in einem Bezug auf eine Kraft, die außerhalb seiner selbst liege.
Wie man als Betroffener Rituale kritisieren und überwinden kann, ist schließlich bei Dücker nachzulesen: Die originellste These seines Kompendiums besagt, dass Ritualkritik oft in Form einer neu programmierten Ritualpraxis erfolgt. Das wäre dann aber kein Trost für die gebeutelte Universität, die erst die Talare, dann die Achtundsechziger und schließlich die Evaluatoren über sich ergehen lassen musste: Nach dem Ritual ist immer vor dem Ritual.
MILOS VEC
Burckhard Dücker: Rituale. Formen - Funktionen - Geschichte. Eine Einführung in die Ritualwissenschaft, Stuttgart und Weimar 2007.
Sandrine Garcia: "L'expert et le profane: qui est juge de la qualité universitaire?" Genèses. Sciences sociales et histoire, Heft 70, März 2008.
Ralf Oberndörfer: "Die mündliche Prüfung im Ersten Juristischen Staatsexamen als Initiationsritual. Manchmal Albtraum noch nach Jahrzehnten - Disziplinierungs-, Kontroll- und Normierungsinstrument ohne wirklichen Nutzen", Betrifft Justiz Nr. 88, 2006.
Christine Schwarz: Evaluation als modernes Ritual. Zur Ambivalenz gesellschaftlicher Rationalisierung am Beispiel virtueller Universitätsprojekte, Hamburg 2006.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main