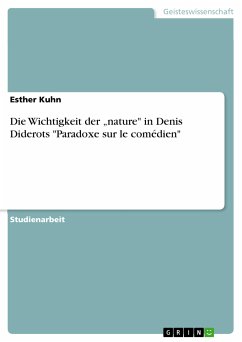Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Theaterwissenschaft, Tanz, Note: 1,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Theater- und Medienwissenschaft), Veranstaltung: Proseminar "Theater und Bild", Sprache: Deutsch, Abstract: Bilder und die damit verbundene visuelle Wahrnehmung erscheinen heutzutage übermächtig. Was Georg Simmel bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit "Steigerung des Nervenlebens" beschreibt, ist heute durch eine globalisierte und von immer neuen (Kommunikations-)Technologien beschleunigte Welt noch stärker präsent: Ständig ziehen Bilder an uns vorüber, egal ob innerhalb von Filmen, in Flugzeug oder Zug, auf Plakaten, Leuchtreklamen oder Ähnlichem. Das Sehen, so scheint es, ist der Sinn, der in der modernen Welt am meisten beansprucht wird. Betrachtet man das Theater und seine Geschichte, findet schon in der Barockepoche ein Wechsel statt, bei dem die Visualität in den Vordergrund gerät und der für die Entstehung des Begriffs der Inszenierung konstituierend ist: Der Paradigmenwechsel von der Dominanz des dramatischen Textes hin zu den visuellen Zeichen, der sich laut Christopher Balme zum einen an der Theatralität der Historienmalerei des 17. Jahrhunderts, die als passendes Modell für das Schauspiel fungierte, zeige. Zum anderen finde im 18. Jahrhundert eine Transformation von Begriffen der Literatur- und Kunsttheorie auf die Theatertheorie und eine Annäherung von Malerei und Schauspiel statt. Dieses Primat des Visuellen, diese Anlehnung des Theaters an die Malerei zeigt sich auch in der Tableautheorie eines aufklärerischen Schriftstellers - Denis Diderot. Laut dieser soll sich "sowohl die Dramaturgie eines Stückes als auch seine Aufführungspraxis an der Logik des Bildes orientieren [...]." Zurück zur Gegenwart: Auch ein zeitgenössischer Theatermacher gibt der Visualität den Vorrang, wendet sich vom Sprechtheater ab und den Bildern zu: Robert Wilson. Dessen vielzitiertes "Theater der Bilder" eignet sich in meinem Empfinden für eine Analyse mit dieser besonderen Folie der Tableautheorie, da Wilson sich ebenso wie Diderot vom "stummen Spiel" leiten lässt. Die Tableautheorie Diderots auf die Inszenierungspraxis Robert Wilsons zu übertragen - genauer: auf Wilsons Inszenierung der "Hamletmaschine" - soll deshalb Aufgabe dieser Arbeit sein. Es soll untersucht werden, ob es möglich ist, ein historisches Konzept mit einer modernen Aufführung zu vereinbaren, und wenn ja, inwieweit dies realisierbar ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.