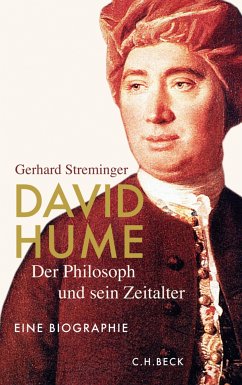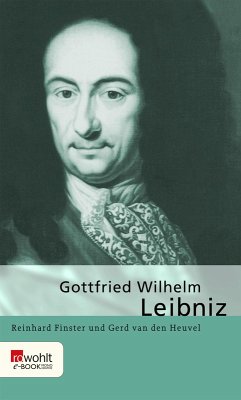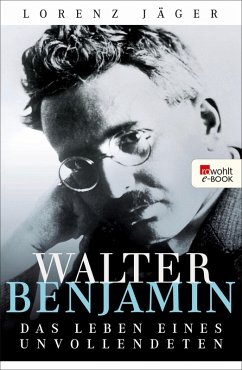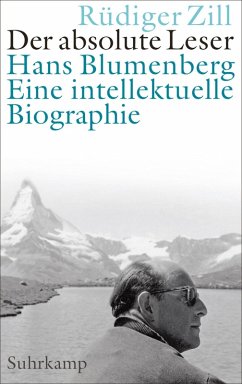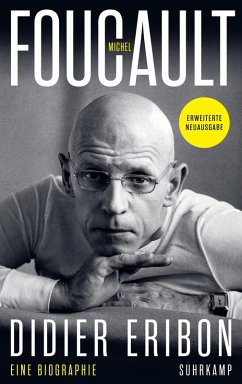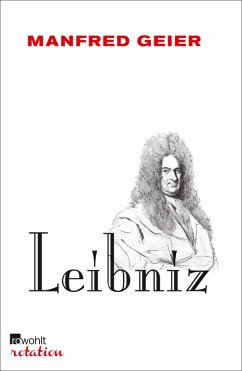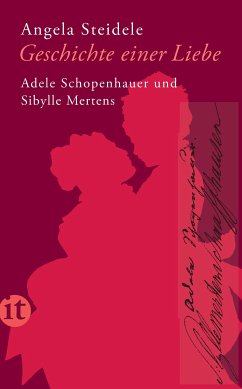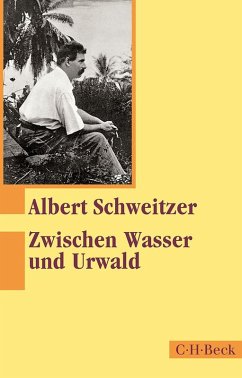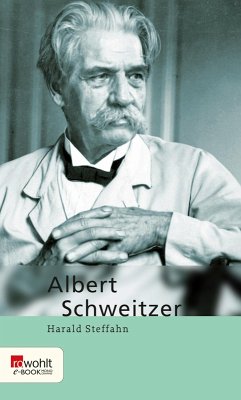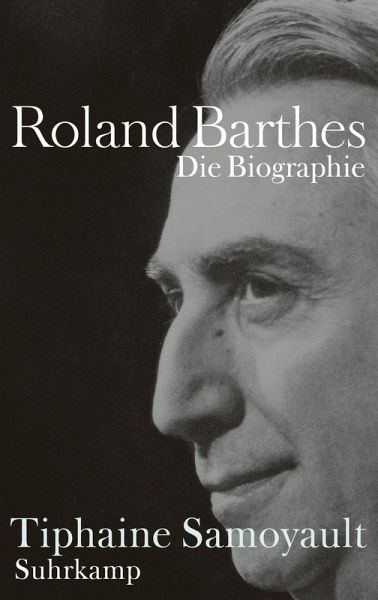
Roland Barthes (eBook, ePUB)
Die Biographie
Übersetzer: Künzli, Lis; Hoffmann-Dartevelle, Maria
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 38,00 €**
32,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Roland Barthes hat die Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Lesen gelehrt. Er hat vorgeführt, wie die alltäglichen Dinge, die Mythen des Alltags, zu verstehen sind; er hat das Alphabet der Sprache der Liebe vorbuchstabiert; er hat die Lust am Text propagiert; er hat die Stellung des Autors untergraben - und in seinem letzten Seminar, der »Vorbereitung des Romans«, gestanden, er hätte sich gewünscht, Romancier zu werden. 1915 in Cherbourg geboren, geht er in den Dreißiger Jahren zum Studium nach Paris. Hier sammelt er erst politische Erfahrung, entdeckt die Freundschaft u...
Roland Barthes hat die Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Lesen gelehrt. Er hat vorgeführt, wie die alltäglichen Dinge, die Mythen des Alltags, zu verstehen sind; er hat das Alphabet der Sprache der Liebe vorbuchstabiert; er hat die Lust am Text propagiert; er hat die Stellung des Autors untergraben - und in seinem letzten Seminar, der »Vorbereitung des Romans«, gestanden, er hätte sich gewünscht, Romancier zu werden. 1915 in Cherbourg geboren, geht er in den Dreißiger Jahren zum Studium nach Paris. Hier sammelt er erst politische Erfahrung, entdeckt die Freundschaft und seine Homosexualität - und am Ende des Jahrzehnts befällt ihn eine Tuberkulose, die in ihn zu langjährigen Sanatoriumsaufenthalten zwingt. Dieser Abbruch einer normalen akademischen Karriere erklärt das späte Erscheinen seines Buches, Am »Nullpunkt der Literatur« (1957) und ist zugleich verantwortlich für seine Schreib- und Forscherhaltung: die überkommenen unverrückbaren universitären Wahrheiten enthüllt er als eine Form des Nicht-Wissens, an deren Stelle er eine neue Wissensform entfaltet. Die Schriftstellerin und Literaturhistorikerin Tiphaine Samoyault entwirft unter Rückgriff auf bisher unzugängliche persönliche Dokumente von Roland Barthes die erste umfassende, alle Aspekte von Werk und Leben ausleuchtende, Biographie. Als Wissenschaftlerin und Literatin liest sie die Person Roland Barthes und dessen Schreiben - und damit die Bedeutung dieses Autors für unsere Zeit.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.