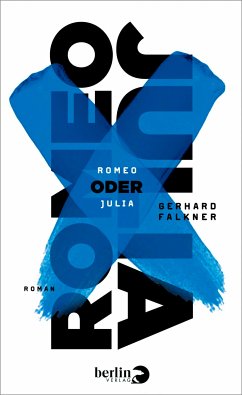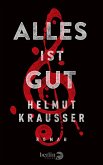Zum Zeitpunkt, da ich diese Rezension schreibe, ist "Romeo oder Julia" für den Deutschen Buchpreis nominiert und hat es bereits auf die Shortlist geschafft, ist also eines von sechs Büchern, die in die engere Auswahl aufgenommen wurden.
Obwohl ich normalerweise nicht davor zurückscheue, meine
Meinung ehrlich zu äußern und gegebenenfalls auch negative Rezensionen zu schreiben, fällt mir das bei…mehrZum Zeitpunkt, da ich diese Rezension schreibe, ist "Romeo oder Julia" für den Deutschen Buchpreis nominiert und hat es bereits auf die Shortlist geschafft, ist also eines von sechs Büchern, die in die engere Auswahl aufgenommen wurden.
Obwohl ich normalerweise nicht davor zurückscheue, meine Meinung ehrlich zu äußern und gegebenenfalls auch negative Rezensionen zu schreiben, fällt mir das bei Büchern, die Preisträger oder zumindest Preisanwärter sind, schwer. Menschen, die ohne Zweifel belesener sind als ich, die mehr von Literatur und vom Literaturbetrieb verstehen, haben das Buch für auszeichnungswürdig befunden. Wer bin ich also, dem zu widersprechen?
Die einfachste Antwort: ich bin eine Leserin, die sich von diesem Buch herb enttäuscht fühlt. Die Prämisse klingt originell, eine Mischung aus Krimi, Einblicken in den Literaturbetrieb und möglicherweise einem Hauch Drama. Tatsächlich verrät der Klappentext jedoch schon fast alles, was in diesem Buch passiert – die Handlung erschien mir etwas dürftig für 272 Seiten.
Natürlich gibt es Bücher, die nicht durch ihre Handlung bestechen, sondern durch andere Eigenschaften, wie unvergessliche Charaktere, atemberaubende Sprachgewalt oder die Art und Weise, wie sie den Leser aus seiner Komfortzone zerren und ihn zwingen, die Welt oder sich selbst in einem neuen Licht zu sehen. Von "Romeo oder Julia" fühlte ich mich indes selten bestochen, sondern über lange Passagen sogar gelangweilt.
Das Krimi-Element der Geschichte, das für Spannung hätte sorgen können, läuft in meinen Augen halbherzig nebenher und stößt auch kein sonderliches Charakterwachstum an. Ab und zu passiert etwas, das sich Protagonist Kurt nicht erklären kann, was ihn zunehmend beunruhigt, aber richtig dramatisch ist das alles nicht – jedenfalls bis zum Schluss, wenn sich das Rätsel rasant aufklärt und auch schon wieder vorbei ist, bevor Kurt und der Leser Zeit haben, daraus mehr zu ziehen als vage Bestürzung. Einen Teil der Auflösung hatte ich mir tatsächlich schon gedacht, denn der wird nach etwa einem Drittel des Buches angedeutet.
"Obwohl ich Kurt heiße, bin ich Schriftsteller. Allerdings bin ich weit davon entfernt, mir auf dieses Tatsache etwas einzubilden."
(Zitat)
Kurt Prinzhorn ist einer, der in seinen jungen, 'selig vernebelten' Jahren aus einem literarischen Rausch heraus schrieb, das Schreiben inzwischen aber als eine 'Art von gehobenem Selbstmord' empfindet. Dementsprechend lesen sich die Geschehnisse, durch seine Augen gesehen, oft wie eine Satire auf den Literaturbetrieb: selbstverliebte Schriftsteller unterhalten sich wodkatrunken über Nichtigkeiten und würzen diese Belanglosigkeit mit einer Vielzahl von (meist offensichtlichen) Anspielungen auf Literatur, Film und Kunst.
Mal ist das clever und unterhaltsam, mit wunderbar verunglückten Metaphern und schwülstigen Sätzen seitens Kurt, der vielleicht doch nicht so weit davon entfernt ist, sich auf seinen Genius etwas einzubilden. Auch gibt es durchaus einige Passagen, in denen ihm dann doch Momente der Sprachpoesie glücken – und manchmal fand ich es schwer, zu unterscheiden, wo das eine aufhörte und das andere anfing.
Dann wiederum fühlte ich mich, als würde Kurt mir, der Leserin, ausführlich von den Freuden einer bereits vergangenen Party erzählen, zu der ohnehin nur Schriftsteller eingeladen waren. Manchmal ist das so mit Literatur über Literatur.
»Hab ich dir eigentlich gesagt, dass mich deine schnittlauchgrünen Augen jedes Mal begeistern, wenn ich dich ansehe?« »Meine wasgrünen?« »Sie sind wirklich sehr schön«, sagte ich, »wie ein tiefer Blick in den Dschungel.«
(Zitat)
Keiner der Charaktere ging mir wirklich nahe, sogar Kurt blieb mir bis zum bitteren Ende fremd. Denn der steht in steter Distanz zu sich selbst – als würde er, der sich über seinen Status als Schriftsteller definiert, seine Gedanken dem eigenen Lektorat unterwerfen. Als Leser sieht man daher weniger sein wahres Ich als sein konstruiertes Selbstbild.