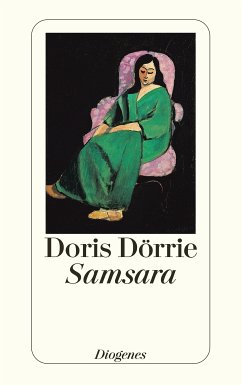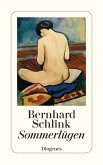Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Doris Dörrie leidet unbeschreiblich / Von Hannelore Schlaffer
Bescheidenheit auf Buchtiteln ist selten. Doris Dörrie aber ist erfolgreich genug, um sich in einer Zeit, da jeder Autor auf nichts mehr stolz ist als darauf, einen Roman oder sonst ein zusammenhängendes Buch geschrieben zu haben, das Understatement zu leisten, ihre Geschichte des weiblichen Masochismus als eine Sammlung von "Erzählungen" anzukündigen. Freilich können die Texte über Clara, Claudia, Juno und Paul und über die verschiedenen Annas, die auf die gehörigen zwanzig Seiten geplant sind, die eine entspannte Lesestunde ausfüllen, auch als einzelne Erzählungen gelesen werden. Sie sind alle in sich geschlossen, beginnen mit einem markanten Auftritt und enden mit einem Schlußpunkt, der Deklaration eines Selbstbewußtseins, das keine Widerrede und also auch keine Fortsetzung der Handlung duldet. Manchmal enden sie sogar mit der Einlieferung der Hauptfigur ins Krankenhaus oder mit einem ausgelassenen Striptease in der ausgedörrten Landschaft Amerikas, über den hinaus selbst die Autorin nicht mehr viel Überraschendes zu verraten hat.
Aber nicht nur die gemeinsamen Namen der Personen schließen, wie im Falle von Juno und Paul, die Erzählungen zu Szenen einer Ehe zusammen. Die beiden Erzählungen, in denen dieses Paar auftritt, sind Spiegelungen ein und derselben Situation unter verschiedenen Aspekten. Ob Juno einen Drehbuchautor in Los Angeles verführt oder Paul eine Frau in Urspring - das hat, je nachdem, aus welcher Perspektive erzählt wird, nicht die gleichen Folgen. Juno zieht aus ihrer eigenen Untreue keinerlei Konsequenzen, die von Paul aber entzündet in ihr Zerstörungsträume.
Das Buch also ist ein Spiegelkabinett, in dem alle Augenblicke dieselben Gesichter anders dreinschauen und sich unähnliche ganz gleich sehen. Der Reigen, zu dem Anspielungen, Symbole und parallele Konstellationen die einzelnen Texte zusammenschließen, ergibt jedoch im ganzen weder ein "Decamerone" noch ein "Seldwyla", wo eine bunte Gesellschaft aus vielen Figuren alle möglichen menschlichen Schwächen und Narreteien entblößt. Ganz im Gegenteil ist das Potpourri der Erzählungen in der Tat ein Eintopf aus den immer gleichen emotionalen Ingredienzen. Alle Erzählungen widmen sich der weiblichen Erbsünde schlechthin: der Sucht, sich selbst unglücklich zu machen. Seinen modischen Ausdruck hat dieses Laster in der Anorexie gefunden.
Das Buch enthält eine einzige großartige Szene: den Kampf eines Kleinkinds mit seiner Mutter um den gemeinsamen Mittagsschlaf. Die Stunde des Tages, an dem es der Mutter, die seit der nächtlichen Pflege des Säuglings unter chronischer Schlaflosigkeit leidet, gelingt, sich auszuruhen, ist die kurze Zeit, da das Kind nach dem Mittagessen einschläft. Todesschrecken packt sie daher, als eines Tages das Kind trotzig behauptet, nicht mehr schlafen zu wollen, und ein Kampf auf Leben und Tod setzt ein um diese eine stille Stunde des Tages, den freilich, die Natur will es so, die Tochter gewinnt. Diese Auseinandersetzung eines kleinen Körpers mit großer Energie gegen ein erwachsenes Bewußtsein ist die Kernszene des Buches, aus der sich Leid und Haß gebiert, Schlaflosigkeit, Essensverweigerung, Unterernährung, Bulimie, Flagellantismus.
Das psychoanalytische Muster, in das diese unvergeßliche Szene eingefangen ist, ist nur zu bekannt: Der Kampf zwischen Mutter und Tochter währt ein Leben lang und macht die Tochter zur Anorektikerin. Dem Desinteresse des wohlunterrichteten Lesers arbeitet daher Doris Dörrie entgegen durch die Übertragung dieser modernen Leidensgeschichte in eine mittelalterliche Legende. Das Pendant zur Anorektikerin ist Anna, die Hungerkünstlerin des sechzehnten Jahrhunderts, die sich schließlich zur Heiligen hocharbeitet. Die Stationen ihres Leidensweges, der sich in einzelnen Erzählpassagen entfaltet, sind zwischen die Familienszenen aus der Gegenwart eingestreut und bilden das Rückgrat des Buches. Aus den wiederholten Spiegelungen von Vergangenheit und Gegenwart entsteht eine Märtyrergeschichte der weiblichen Selbstverachtung, die sich ohne Wandel durch alle Zeiten hindurchzieht: um sich auszudrücken, hatten Frauen nie eine andere Möglichkeit, als sich zu kasteien.
Seit Elfriede Jelinek weiß jede Frau, die schreibt, daß sie sich hartgesotten geben muß. Der Masochismus der heutigen, vor allem aber der frühneuzeitlichen Anna gibt Doris Dörrie die Gelegenheit, seelische Kaltblütigkeit und literarische Kaltschnäuzigkeit zu beweisen. Der Stoizismus der Autorin hält mit dem der heiligen Anna Schritt, als die Mitschwestern diese auf die Probe stellen, indem sie ihr das ohnehin spärliche Essen zusätzlich noch verderben: "Und ehe ich mich versehe", berichtet Anna - oder beichtet sie dem Leser? -, "bewegt sich mein Arm und greift zum Löffel und läßt ihn in die Suppe sinken, bis der ekelhafte Blutegel auf dem Löffel zu liegen kommt, und mein Arm führt den Löffel zum Mund, meine Lippen öffnen sich, der Blutegel schlüpft auf meine Zunge, ich spüre, wie er sich windet und dann unendlich langsam meinen Hals hinunterrutscht. . . . Am nächsten Tag ist mein Essen mit Katzenkot bedeckt. Ich esse. . . . Am nächsten Tag finde ich ein Knäuel Haare . . ., den Kopf einer Kröte . . ., eine halb zerfleischte, tote Maus."
Die Schikanen, die der Stil der Legende rechtfertigt, müssen, so verlangt es das feministische Denkmodell, ihre Gültigkeit auch für die Frauen von heute haben. Die Autorin macht sich also in den Erzählungen, die in der Gegenwart spielen, an die Leserin heran, indem sie deren abgetragene Sprache imitiert. Doris Dörrie stellt die Einsicht, die sie als humoristische Filmregisseurin bewiesen hat, daß eine Kopie noch keine kunstvolle Mimesis ist, hintan, wenn sie die Umgangssprache und das Alltagsbewußtsein der heutigen Frauen bereits für die Elemente einer lesenswerten Literatur hält. Die Langweiligkeit dieser Sprache hat sie selbst gespürt und ist deshalb zu den Effekten der Legende und des Masochismus geflüchtet. Aber auch mit ihnen geht es wie beim Budenschießen: Es fallen, wenn überhaupt man trifft, nur Attrappen.
Doris Dörrie: "Samsara". Erzählungen. Diogenes Verlag, Zürich 1996. 329 S., geb., 39,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main