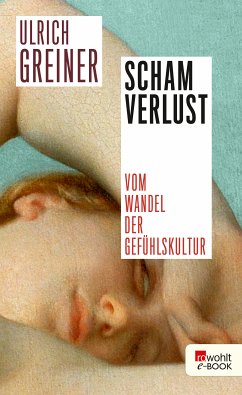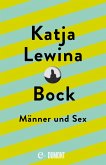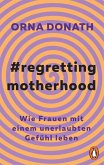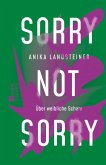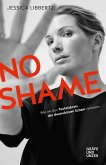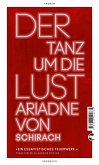Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
"Greiner ist ein glänzender Nacherzähler." -- Der Tagesspiegel über "Ulrich Greiners Leseverführer"
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Nie ohne Wasserflasche: Ulrich Greiners Studie zum öffentlichen Benehmen
Der bekannte Literaturkritiker beginnt mit einer Erinnerung. Er war einer der Zeugen des "Busen-Attentats" von drei jungen Frauen auf Theodor W. Adorno im Frühjahr 1969. Der Philosoph wurde, so berichtet Greiner, "von den Studentinnen umringt, die ihre Jacken öffneten und ihn mit ihren nackten Brüsten bedrängten. Adorno wehrte sich mit erhobener Aktentasche und floh aus dem Saal." Greiner war im Hörsaal. Bemerkenswert erscheint ihm im Rückblick, dass alle Beteiligten - manche sofort, andere später - sich schämten. Hannah Weitemeier, die mitgetan hatte, sagte in einem Interview 2003: "Wäre ich tot und würde Adorno begegnen, ich würde ihn bitten, dass er mir vergibt."
Inzwischen haben sich die Schamgrenzen weiter verschoben. Die radikalfeministische Gruppe "Femen" hat solche Aktionen fast veralltäglicht; im Februar dieses Jahres traten zwei Femen-Aktivistinnen in Dresden zum Jahrestag der Bombardierung auf, die Bezirksverordnete der Piraten für Neukölln hatte dabei "Thanks Bomber Harris" auf ihren Oberkörper geschrieben. Aber die Grenzen des Schicklichen wurden seit 1969 auch noch viel weiter ausgeleiert - so sehr, dass es nur die Älteren (zu denen Greiner, Jahrgang 1945, gehört) überhaupt noch bemerken. Das ständige öffentliche Trinken aus Wasserflaschen gehört zu diesem Symptomkreis, gerechtfertigt mit der Gefahr der Dehydrierung. Man fragt sich, wie die Menschen früher überhaupt leben konnten.
Nacktproteste sind also nicht der einzige Befund in Greiners Buch. Am Anfang standen die Achtundsechziger: "Ihr Ziel bestand darin, alle Schamgefühle und Intimitätsbedürfnisse als Relikte einer bürgerlichen Kultur zu begreifen, die es zu überwinden galt." Gleichzeitig unterlagen die Achtundsechziger ebenso wie ihre Kritiker aber einer Selbsttäuschung. Denn der Radikal-Hedonismus, den die Aktivisten für sozialistisch hielten, war nur der Beginn eines neuen moralischen Konsenses, der, so Greiners Vermutung, wie angegossen zum globalisierten Kapitalismus passt, der mit Traditionen aufräumen musste. Solche Beobachtungen sind triftig, aber man hat sie so ähnlich auch schon anderswo gelesen. Und als kulturkritischer Traktat genommen, ist das Buch zu moderat, ein paar Tiefschläge mehr, meinetwegen auch "fundamentalistische", hätte man sich schon gefallen lassen.
Greiners Anspruch reicht aber weiter. Er geht tief in die Literatur- und Ideengeschichte. Aber auch als literaturwissenschaftliche Abhandlung genommen, befriedigt das Buch, eine Galerie beschämter Helden, nicht gänzlich. Dabei hat Greiner doch eine These. Sie lautet, dass "an die Stelle der alten Schuldkultur und der noch älteren Schamkultur eine neue Kultur getreten ist: die Kultur der Peinlichkeit". Schuld und Scham setzten ein Gewissen voraus, Peinlichkeit aber nur eine Umgangsform - Tragik falle nun aus. Aber diese klare Grenze löst sich wieder auf, wenn es etwa von einer Szene in Dostojewskis "Doppelgänger" heißt, sie sei "der Anfang eines einzigen Schamexzesses, einer Kette von Peinlichkeiten, Beschämungen und vernichtenden Erlebnissen". Und ob die Tragik wirklich, wie Greiner glaubt, verschwindet? Die Selbstmorde nach Mobbing in sozialen Netzwerken legen einen anderen Schluss nahe.
LORENZ JÄGER
Ulrich Greiner: "Schamverlust". Vom Wandel der Gefühlskultur. Rowohlt Verlag, Reinbek 2014. 352 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main