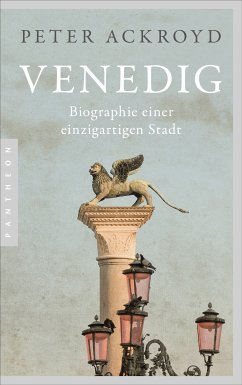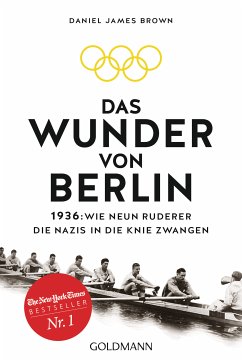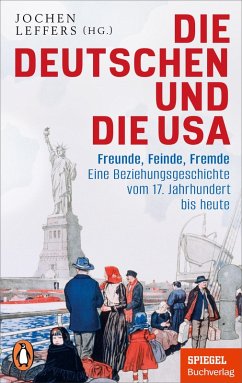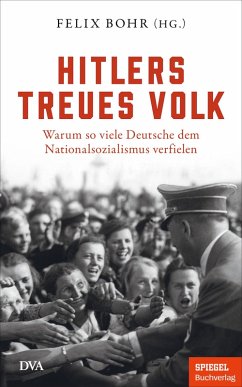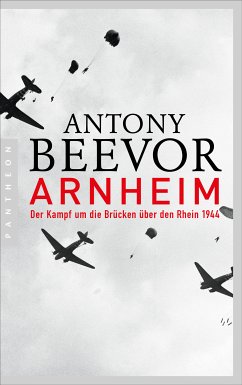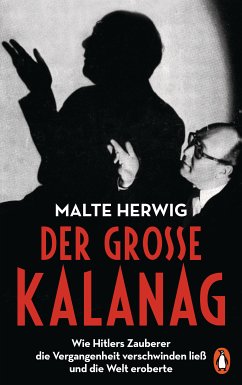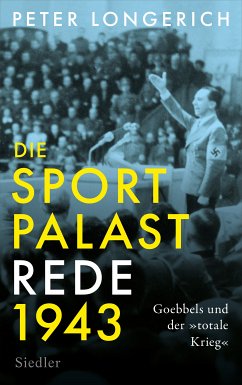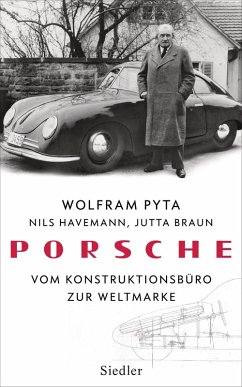Schattenexistenz (eBook, ePUB)
Jüdische U-Boote in Wien 1938-1945
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 28,00 €**
11,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sich verstecken - was bedeutet das tatsächlich? Und was bedeutete es für Jüdinnen und Juden, die in der Zeit des Nationalsozialismus, am Leben bedroht, entschieden, unterzutauchen? Wie viele waren sie, wer half ihnen, wie viele überlebten den Naziterror? Welche Auswirkungen hatte das jahrelange Verstecken auf die Psyche der Betroffenen und wie ging man nach dem Ende des Krieges mit den Überlebenden um? Brigitte Ungar-Klein beantwortet diese Fragen in der ersten umfassenden Studie über Verfolgte des NS-Regimes, die in Wien untertauchen konnten. Sie führte zahlreiche Interviews und Gespr�...
Sich verstecken - was bedeutet das tatsächlich? Und was bedeutete es für Jüdinnen und Juden, die in der Zeit des Nationalsozialismus, am Leben bedroht, entschieden, unterzutauchen? Wie viele waren sie, wer half ihnen, wie viele überlebten den Naziterror? Welche Auswirkungen hatte das jahrelange Verstecken auf die Psyche der Betroffenen und wie ging man nach dem Ende des Krieges mit den Überlebenden um? Brigitte Ungar-Klein beantwortet diese Fragen in der ersten umfassenden Studie über Verfolgte des NS-Regimes, die in Wien untertauchen konnten. Sie führte zahlreiche Interviews und Gespräche mit Überlebenden und deren Helferinnen und Helfern, den stillen Heldinnen und Helden, und verarbeitete unzählige schriftliche Quellen. Ungar-Klein erzählt die Geschichten der Untergetauchten und der Helfenden und bringt so erstmals ein verborgenes Universum ans Licht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.