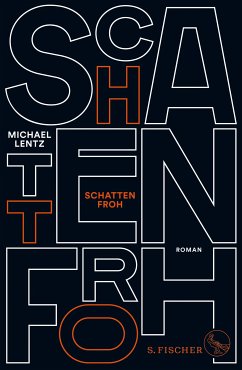Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Schreiben können nur wir Menschen: Michael Lentz erzählt mit "Schattenfroh" seinen Vater und seine zerstörte Heimatstadt zurück ins Leben.
Der erste und der letzte Satz dieses Buchs lauten gleich, und zwischen ihnen liegen exakt tausend Seiten. "Man nennt es schreiben", so steht es am Anfang und am Ende, und dazwischen wird schreibend vorgeführt, was das alles heißen kann: konkret und assoziativ schreiben, vorwärts und rückwärts, buchstäblich und anagrammatisch, konventionell und kopfstehend, in Antiqua und Fraktur, gedruckt und handschriftlich, schwarz auf weiß und verblassend, todernst und wortspielerisch, verstörend und betörend. "Schattenfroh" von Michael Lentz ist ein Buch der Gegen-Sätze: ein permanenter Zwist von Vater und Sohn, Leben und Sterben, von Gegenwart und Vergangenheit, von Wirklichkeit und Literatur. "Das ist nicht mein Buch", sagt sein Erzähler nach mehr als achthundert Seiten, "was hier gedruckt wird. Mein Buch ist ein absolutes Buch, es hat apokryphe Teile und zwei Zentren, mein Buch ist eine Person als zwei, das sind mein Vater und das bin ich."
Die grammatikalisch unmögliche Formulierung des letzten Satzteils ist kein Versehen, schon gar kein Verschreiben. Sie drückt eben die Differenz zwischen Vater und Sohn aus. Alles in "Schattenfroh" ist mehrdeutig und dabei so minutiös konstruiert, dass man nach der ersten Lektüre direkt die zweite beginnen sollte, um die grundlegende Zweiteilung des Buchs erst richtig schätzen zu lernen. Sie bildet den Zwiespalt ab, in dem sich der Erzähler befindet: als schreibend Beschriebener, der nur zu genau weiß, dass er gar keine letzte Gewalt hat über das, was er da erzählt. Weil "Schattenfroh" kein Roman ist, sondern gemäß der von Lentz gewählten Genrebezeichnung ein Requiem, und zum Requiem gehört der Tod. Er entzieht sich allem Begreifen, weil er nicht selbst erlebt werden kann. Und doch empfindet man den Tod zutiefst: als Hinterbliebener.
Am 20. August 2014 ist der Vater von Michael Lentz gestorben, sechzehn Jahre nach der Mutter, deren Tod damals zum Anlass für das bewegende Buch "Muttersterben" geworden war. "Schattenfroh" ist kein Komplementärstück geworden, dazu sind die beiden Umfänge zu ungleichgewichtig, fünffach dicker ist das Vaterbuch. Man mag es als Variationen über das alte Thema betrachten, denn einiges, was "Schattenfroh" bemerkenswert macht, war in "Muttersterben" schon angelegt (handwerklich etwa eine lange handschriftliche Passage, inhaltlich die wiederkehrenden Exerzitien des Schmerzes), aber wie das neue Buch die Sache angeht, unterscheidet sich gravierend vom Vorläufer. Hier wird ein Verlust zu bewältigen versucht, indem nun dem Verstorbenen eine Stimme verliehen, er zum Mitverfasser des Buchs gemacht wird. "Muttersterben" war radikal subjektiv und darin untröstlich, "Schattenfroh" ist radikal suggestiv und damit zutiefst tröstlich. Ein Requiem eben.
Dessen Ich-Erzähler nennt sich Nemo, "ein schlechtes Omen", wie er sehr früh im Buch selbst sagt, und das ist schon das erste von zahllosen Anagrammen - NEMO, OMEN -, mit denen die Figuren dieses Buchs immer wieder ihre Gestalten wechseln, ohne aber ihre Grundzüge zu verlieren. Schattenfroh ist der Wichtigste dieser Gestaltwandler, und er bleibt als Einziger seinem Namen treu - als Vater, aber auch als Fürst der Unterwelt, als Diktator und nicht zuletzt als der eigentliche Autor des Buchs: In einem mitten im Text eingestreuten Literaturverzeichnis, das Quellen und Inspirationen für "Schattenfroh" benennt, wird als Verfasser des gleichnamigen Buchs Schattenfroh selbst genannt.
Michael Lentz betreibt also ein gigantisches Vexierspiel, und wer sich darauf einlassen will, muss wissen, dass es in den letzten Jahren kein verrätselteres Buch gegeben hat. Es ist eine Zumutung: Immer wieder springt die Handlung, die aus einem großen Geständnis besteht, das der Ich-Erzähler in einer Zelle ablegt, einer Suada, die uns durch die Vergangenheit der Familie Lentz und die Geschichte ihrer Heimatstadt Düren führt, zwischen den Zeiten und Schauplätzen hin und her. Aber es hat auch kein Buch gegeben, das so unfehlbar immer wieder Episoden bereithält, für die sich der weiteste Leseweg und die größte Lesemühe gelohnt haben. Mehrmals stirbt der Ich-Erzähler selbst, und zwar auf schlimmste Weisen, auf dem Scheiterhaufen wie Jan Hus, auf dem Richtblock wie Thomas Müntzer, und riesige, nahezu unerträgliche Passagen sind den technischen Aspekten dieser und anderer Hinrichtungen gewidmet, der Kreuzigung Christi etwa oder einer Pfählung, die Lentz aus Ivo Andrics Roman "Brücke über die Drina" entnommen hat.
Es gibt dergleichen Anleihen zuhauf in "Schattenfroh", nicht nur bei der Literatur, wo nur zum Beispiel noch "Tristram Shandy" zu nennen wäre, aus dem Lentz das Prinzip einer schwarzen Seite entlehnt hat, oder die Kuckucksseite aus dem spanischen "Don Quijote", die unvermittelt in "Schattenfroh" auftaucht. Noch prägender für das Buch sind jedoch Vor-Bilder im wörtlichen Sinne: Hieronymus Boschs Visionen, Vermeers Interieurs oder, als Auslöser eines besonders virtuosen Stücks der Bildaneignung, Werner Tübkes Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen, das Lentz indes in Prüm umbenennt und samt dem Geschehen des Jahres 1525 in die Eifel verlegt, einem weiteren familiär wichtigen Schauplatz des Requiems. Selbst die damals beteiligten Fürsten sind nun Herrscher über Gebiete in der Eifel; die fiebrig phantasierende Geschichtsschreibung von "Schattenfroh" wird auf die Spitze getrieben. Prüm ist wie jede biographische Station des Ich-Erzählers ein Schreckensort. Hier durchlebt auch der Großvater des Erzählers in der Nazi-Zeit seinen Kreuzweg in der Verhörzelle, und diese historische Konstellation ähnelt der Gnadenlosigkeit, mit der Schattenfroh den eigenen Sohn diszipliniert.
Doch der zentrale Handlungsort ist Düren, "Stadt der Toten, Steinwüste". Im dortigen Verwaltungsgebäude, wo der Vater eine leitende Stellung innehatte, tritt der Erzähler durch einen Wandteppich in dessen Büro in seine Heimatstadt während der Dreißigjährigen Kriegs ein. Akribisch folgt er bei seinem Weg durchs frühneuzeitliche Düren den historischen Stadtansichten, wie die aus dem Geist der Literatur vollzogene Wiederauferstehung des toten Vaters in "Schattenfroh" wird auch die der Stadt betrieben. Denn Düren ist ebenfalls gestorben, am 16. November 1944 im alliierten Bombenhagel, bei dem mehr als dreitausend Menschen ihr Leben verloren. In der kompromisslosesten Episode von "Schattenfroh" hat Lentz alle die Namen der Bombenopfer, ihr jeweiliges Alter und die Herkunftsorte per Hand aufgeschrieben, eine 75 Buchseiten umfassende Liste als eigenes Requiem im Requiem. Der Tod führt in "Schattenfroh" permanent Regie.
Wobei es auch burleske Passagen gibt. Etwa die an Doderer erinnernde Schilderung der Verzweiflung der Untergebenen des Vaters über dessen dienstliche Monologe: "Man hat Mitglieder des Rates und der verschiedenen Haupt-, Neben- und Unterausschüsse dabei beobachtet, wie sie die oft über Stunden geführten Reden meines Vaters in der Luft zerrissen, und als das noch nicht genug war, ihre überschäumende Wut zu befrieden, von der Galerie regnete es Konfetti wie Rosenmontag, schlugen sie ihren Kopf gegen die Wand, was in der Kassenhalle des Gebäudes eigenartig nachhallte, so dass eigens ein Ausschuss einberufen wurde, in dem über mögliche Polsterungen des Büros beraten werden sollte, zu diesem Ausschuss ist aber niemand erschienen, als bekannt wurde, dass sich auch mein Vater zu den Beratungen angekündigt hatte, man vermutete wohl nicht zu Unrecht, dass er sich nur anschauen wollte, wer von seinen erklärten, vermuteten und verkappten Gegnern sich seinetwegen am meisten Leid zufügte." Angesichts solch langer Sätze ist die provozierend freche skatologische Lesart von Thomas Manns Schreibstil, die in "Schattenfroh" einmal durchexerziert wird, auch erfrischend selbstironisch. Ja, lange, schier endlose Sätze gibt es bei Lentz oft, aber sie sind durchrhythmisiert mit aller Erfahrung, die dem Lyriker, der Lentz ja vor allem ist, zur Verfügung steht, und das ganze Buch, kapitellos über seine mehr als tausend Seiten hinweg, ist dementsprechend ein Kunststück der Tempo- und Pathosvariation, zu der eben auch das Umkippen ins Komische und dann wieder ins Tragische gehört, zeitweise innerhalb eines einzigen Satzes.
Aber hinter all der Virtuosität des Schreibens und des Lesens, hinter all dem Einfalls- und Geistreichtum, dem literarischen und kunstgeschichtlichen Zitieren, Collagieren und Montieren steht als Grundantrieb des Buchs die Fassungslosigkeit angesichts des Vatertodes. Es ist ein Paradox: Aus der völligen Passivität der Verlusterfahrung ist ein gewaltiges Prosawerk entstanden, dessen Erzähler aber immer noch als ein Gehetzter auftritt, der selbst vom Tod immer wieder ereilt wird. Über den Tod des Vaters ist Michael Lentz ebenso wenig hinweggekommen wie über den der Mutter. Dass daraus jedoch Literatur wie "Schattenfroh" und "Muttersterben" hat entstehen können, maßlos im Anspruch wie im Können, ist die Revanche des Schriftstellers: "Bei uns ist alles in der Familie geblieben, bis heute. Nur die Familie ist nicht in der Familie geblieben. Sie ist in die Schrift gegangen." Da wird sie leben, solange gelesen wird.
ANDREAS PLATTHAUS
Michael Lentz: "Schattenfroh". Ein Requiem.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2018. 1008 S., Abb., geb., 36,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH