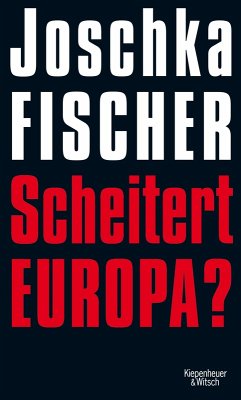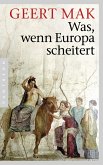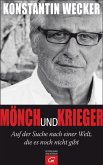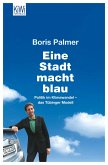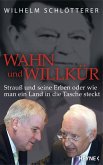Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Was Joschka Fischer meint
Im Grundsatz ist vieles richtig, was Joschka Fischer zur europäischen Einigungspolitik schreibt: In der Schuldenkrise der Eurozone haben Populisten auf beiden Seiten leichtes Spiel, bei den Geberländern wie bei den Schuldnern. Die daraus resultierenden nationalistischen Affekte gefährden den europäischen Zusammenhalt. Putins Neoimperialismus und der Abbau des amerikanischen Überengagements lassen sicherheitspolitisches Trittbrettfahren der Europäer nicht mehr zu; auseinanderdividiert drohen sie nicht nur jeden Einfluss, sondern letztlich auch ihre Selbstbestimmung zu verlieren. Die Europäische Union muss folglich finanz- und sicherheitspolitisch vertieft werden, dabei kommt Frankreich und Deutschland nach wie vor eine gemeinsame Schlüsselrolle zu. Dazu bedarf es mehr politischer Führung und visionärer Überzeugungskraft, als sie in den letzten Jahren beim europäischen Spitzenpersonal zu beobachten waren.
Fischer spitzt jedoch zu, und dadurch entsteht ein verzerrtes Bild. Von einem "monströsen Orkan" ist die Rede, der "Europa im Jahr 2009 mit seiner vollen Wucht getroffen" habe, von der gefährlichsten Krise des europäischen Integrationsprojekts. Im Innern sieht er eine "Souveränitätskrise", ausgelöst durch einen "Bruch mit aller bisherigen deutschen Europapolitik" schon im Oktober 2008, als Angela Merkel die Einrichtung eines gemeinsamen Rettungsfonds zur Bekämpfung der Finanzkrise verweigerte. Dazu kommt für ihn eine "strategische Sicherheitskrise" im Zusammenhang mit der russischen Aggression in der Ukraine und den Gewaltexzessen im Nahen und Mittleren Osten. Das ist schon begrifflich nicht sehr genau. Und die Vorwürfe an die Bundesregierung, die damit verbunden sind, sind überzogen. Man wird sicherlich argumentieren können, dass Merkel auf die Euro-Schuldenkrise allzu zögerlich reagiert und zu stark auf die Stimmung in der öffentlichen Meinung wie im Finanz-Establishment blickte. Aber ihre Reaktion auf die Verordnung einer strikten Austeritätspolitik zu reduzieren und diese dann in erster Linie für die Renationalisierungstendenzen verantwortlich zu machen, kommt jener populistischen Verkürzung gleich, die Fischer sonst zu Recht geißelt.
Ebenso mag man den Mangel an strategischem Verständnis in der breiteren Öffentlichkeit beklagen. Aber daraus eine "strategische Auszeit" Europas "seit mehr als einem Jahrzehnt" abzuleiten, heißt doch, die europäische Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik in Bausch und Bogen als irrelevant abzutun. Fischer scheint das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine zu verurteilen, wenn er behauptet, die Europäer seien hier in naiver Weise in eine Konfrontation mit Russland "quasi hineingetappt". Dass die Unterhändler der EU sehr bewusst überlegt haben, wie der Wunsch einer Mehrheit der Ukrainer nach Zugehörigkeit zur europäischen Gemeinschaft mit den russischen Sicherheitsinteressen vereinbart werden kann, nimmt er nicht zur Kenntnis. Als entscheidenden nächsten Schritt auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat empfiehlt er die Fortentwicklung der Gruppe der Staats- und Regierungschefs zu einer Regierung der Eurozone, verbunden mit der Bildung einer Eurokammer, die aus Vertretern der nationalen Parlamente proportional zusammengesetzt sein würde. "Eine solche Kammer wäre zuständig für den engen, gleichwohl aber wesentlichen europäischen Bereich, in dem die nationalen Parlamente und ihre Vertreter nach wie vor über die Souveränität verfügen, also vor allem in Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftsfragen und in allen Fragen der Subsidiarität." Unklar bleibt, wie Entscheidungen auf europäischer Ebene von Entscheidungen auf nationaler Ebene abgegrenzt werden sollen. Vollends bleibt rätselhaft, wie sie zu größerer Handlungsfähigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik beitragen sollen.
Dies alles irritiert umso mehr, als Fischer an anderer Stelle kritisiert, dass man sich bislang auf weitere wirtschaftliche Marktintegration konzentriert habe, "ohne sich dabei allzu große Gedanken über die Form der endgültigen Ausgestaltung der Union zu machen". Die Monnet-Methode, die er an ihr Ende gekommen sieht, war aber nie so gemeint. Es ging Jean Monnet immer nur um die Konzentration auf das jeweils Machbare. Von diesem Pragmatismus sind auch Fischers Vorschläge nicht weit entfernt. Dass sie tatsächlich auf eine "Neugründung der EU" hinauslaufen, wird man nicht behaupten können. Die Frustration des engagierten Ex-Außenministers, die dem Text anzumerken ist (es sei "oft zum Haareraufen", bemerkt er einmal), ist nachvollziehbar. Dennoch bleibt zu bedauern, dass er sich dadurch zu pauschaler Kritik und wenig durchdachten Forderungen hinreißen lässt. Denn zur Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen der EU wäre guter Rat wirklich willkommen.
WILFRIED LOTH
Joschka Fischer: Scheitert Europa? Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014. 159 S., 17,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH