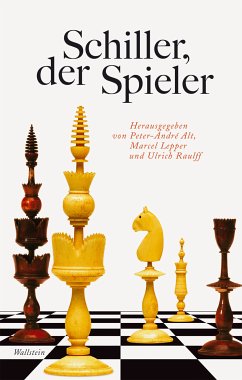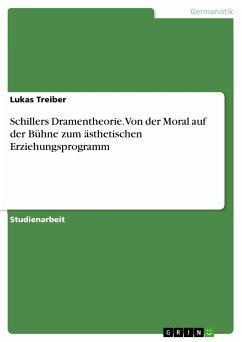Der Spieler Schiller im interdisziplinären Zusammenhang. Als Dramatiker und Erzähler, als Balladenautor und Kulturtheoretiker verband Schiller höchsten intellektuellen Einsatz mit unbändiger Lust an den Spielen der Theaterfantasie, der Sprache und des Denkens. Der Begriff des Spiels ist von entscheidender Bedeutung für sein Werk, für seine Bühnenkunst ebenso wie für seine Rhetorik, für seine lyrische Produktion, seine erzählerischen Texte, seine historischen und ästhetischen Schriften. Den Spieler Schiller in den Blick zu nehmen, erlaubt daher eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit seinem Werk, die unterschiedliche Fachperspektiven aus Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft, Philosophie, Historiographie und Soziologie zusammenführt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.