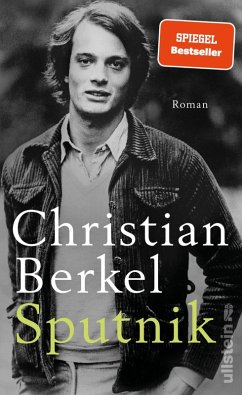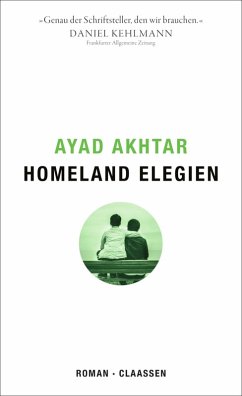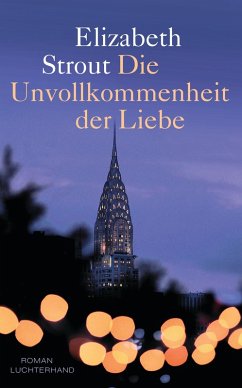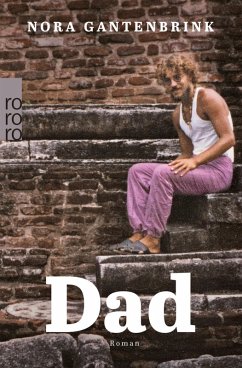Philipp Oehmke
eBook, ePUB
Schönwald (eBook, ePUB)
Roman Großer Familien-Roman in der Tradition amerikanischer Literatur
Sofort per Download lieferbar
Statt: 14,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Eine deutsche Familie, ein großer Roman Anders als Harry findet Ruth Schönwald nicht, dass jedes Gefühl artikuliert, jedes Problem thematisiert werden muss. Sie hätte Karriere machen können, verzichtete aber wegen der Kinder und zugunsten von Harry. Was sie an jenem Abend auf einem Ball ineinander gesehen haben, ist in den kommenden Jahrzehnten nicht immer beiden klar. Inzwischen sind ihre drei Kinder Chris, Karolin und Benni erwachsen. Als Karolin einen queeren Buchladen eröffnet, kommen alle in Berlin zusammen, selbst Chris, der Professor in New York ist und damit das, was Ruth sich im...
Eine deutsche Familie, ein großer Roman Anders als Harry findet Ruth Schönwald nicht, dass jedes Gefühl artikuliert, jedes Problem thematisiert werden muss. Sie hätte Karriere machen können, verzichtete aber wegen der Kinder und zugunsten von Harry. Was sie an jenem Abend auf einem Ball ineinander gesehen haben, ist in den kommenden Jahrzehnten nicht immer beiden klar. Inzwischen sind ihre drei Kinder Chris, Karolin und Benni erwachsen. Als Karolin einen queeren Buchladen eröffnet, kommen alle in Berlin zusammen, selbst Chris, der Professor in New York ist und damit das, was Ruth sich immer erträumte. Dort bricht der alte Konflikt endgültig auf. »Schönwald« ist der mitreißende Roman einer Familie und zweier Generationen, die nie gelernt haben, miteinander zu reden - und die ein großes Geheimnis miteinander verbindet. »>Schönwald< ist ein entlarvender, preisverdächtiger Roman, vielleicht sogar ein Buch des Jahres.« ¿ WDR 5 "Bücher"
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 8.51MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit
Philipp Oehmke, Jahrgang 1974, wuchs in Bonn auf und lebt heute nach Stationen in München und New York als Autor des Spiegel in Berlin und gilt als einer der besten Reporter seiner Generation. 2014 erschien seine Biografie der Toten Hosen, Am Anfang war der Lärm, die viele Wochen unter den Top 10 der Bestsellerliste stand.
Produktdetails
- Verlag: Piper Verlag GmbH
- Seitenzahl: 480
- Erscheinungstermin: 27. Juli 2023
- Deutsch
- ISBN-13: 9783492605397
- Artikelnr.: 67732771
Zu Anfang wirkt die Familie Schönwald bürgerlich langweilig, aber das währt nur kurz. Schnell ergeben sich die ersten Abgründe und die Konflikte, Kontroversen und schwelenden Geheimnisse hören bis zum Schluss nicht wieder auf. Die Familienmitglieder sind allesamt herrlich …
Mehr
Zu Anfang wirkt die Familie Schönwald bürgerlich langweilig, aber das währt nur kurz. Schnell ergeben sich die ersten Abgründe und die Konflikte, Kontroversen und schwelenden Geheimnisse hören bis zum Schluss nicht wieder auf. Die Familienmitglieder sind allesamt herrlich absurd wohlstandsverwahrlost doppelmoralisch. Alle fühlen sich auf selbstgefällige Art und Weise im Recht und sind dabei alle auf ihre eigene Art unerträglich. Das ist sicher überzeichnet, aber jede*r Lesende kann sich wohl irgendwo in oder zwischen den Charakteren wieder finden. Damit kann das Buch zur Selbstreflexion anregen, muss es aber nicht, denn der Autor wertet und verurteilt nicht.
Dabei werden Themen der Zeit wie Queerness, städtische Hipster in Brandenburg, Shitstorms, amerikanische Alt Rights abgehandelt. Und über allem steht das Geld: der Wohlstand, die Selbstverständlichkeit von finanzieller Sorglosigkeit und das (teils unbewusste bzw selbst negierte) Streben nach immer noch mehr Reichtum.
Zwischendurch hat das Roman-Debut des Journalisten Philipp Oehmke schon mal leichte Längen, aber insgesamt fühlte ich mich bitterböse intelligent unterhalten. Ein Spiegel unserer Zeit ohne erhobenen Zeigefinger.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der Buchtitel ist der Name der Familie, deren Leben hier dargestellt wird.
Hans-Harald und Ruth haben drei Kinder. Alle treffen aufeinander, als die Tochter einem queren Buchladen eröffnet und dabei mit Behauptungen über die Herkunft des Familienvermögens konfrontiert wird. …
Mehr
Der Buchtitel ist der Name der Familie, deren Leben hier dargestellt wird.
Hans-Harald und Ruth haben drei Kinder. Alle treffen aufeinander, als die Tochter einem queren Buchladen eröffnet und dabei mit Behauptungen über die Herkunft des Familienvermögens konfrontiert wird.
Die Kapitel widmen sich den einzelnen Personen, alle haben ein Geheimnis, welches sie bisher der Familie nicht offenbart haben.
Chris, der älteste Sohn lebt seit Jahren in den Staaten und ist erst gar nicht begeistert, dass seine Freundin ihm nachreist. Seine Professorenstelle musste er aufgeben und arbeitet nun im Team von Donald Trump. Die Fürsorge für seinen kleinen Bruder ist das einzig Sympathische, das ich seiner Figur anrechnen kann.
Karolin kommt mit dem Leben nicht zurecht, schuld daran sind immer die anderen. Ihre Kindheit ist eng mit dem Freiheitsdrang ihrer Mutter verbunden.
Benni ist der ungeplante Nachzügler, hochintelligenter Familienvater ohne Job, auf der Jagd nach der Lösung eines mathematischen Rätsels. Seine Probleme sind nachvollziehbar, sein Verhalten gegenüber seiner Frau nicht. Die ganze Familie inklusive millionenschwerem Schwiegervater und Stiefschwiegermutter ist erfrischend.
Die Mutter Ruth konnte sich leider nie so verwirklichen wie sie es sich vorgestellt hat. Darunter leidet sie und lässt auch die anderen leiden.
Gegen seine Frau wird Staatsanwalt Hans-Harald eher blass dargestellt. Allerdings berührt mich seine Aufarbeitung der Beziehung zu Ruth. Witzig und klar zieht er seine Schlüsse und bleibt mir sehr positiv in Erinnerung.
Einige Situationen werden aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Manches wird dadurch klarer, manchmal ist es aber zu viel des Guten und hat Längen. Die Themenvielfalt von Missbrauch über familiäre Gewalt, Coming-Out bis zu Internethetze und Vertuschung von Straftaten ist fast zu viel des Guten oder eher Bösen.
Viele Klischees sind in den Lebensläufen untergebracht, aber so hat man schnell ein Bild der Personen vor Augen. Manchmal möchte man sie schütteln, weil sie wieder eine gute Chance verpassen.
Die Behauptung über das Familienvermögen und deren Entkräftungsbemühungen hätte einen größeren Anteil verdient.
Fazit: Die Schönwalds muss man nicht mögen, um ihr Schicksal zu verfolgen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Hier legt Philipp Oehmke ein Buch vor, das man nicht gleich wieder vergessen kann, ein Buch mit dem man sich gedanklich weiter beschäftigt, ein Gesellschaftroman, in dem ganz viele Themen unserer Zeit angesprochen und eingeflochten werden, angefangen von der Bewältigung unserer …
Mehr
Hier legt Philipp Oehmke ein Buch vor, das man nicht gleich wieder vergessen kann, ein Buch mit dem man sich gedanklich weiter beschäftigt, ein Gesellschaftroman, in dem ganz viele Themen unserer Zeit angesprochen und eingeflochten werden, angefangen von der Bewältigung unserer Nazi-Vergangenheit über Homosexualität, Kindesmissbrauch, me-too, MAGA-Bewegung und Trumps Amerika. Und trotz dieser scheinbaren Aktualität sind für mich diese Themen nur Randthemen. Für mich ging es um etwas anderes.
Vom Cover her zeigt es die Frühstücksszene einer gut situierten Familie, der Familienvater schon im Anzug, seine Frau noch im Morgenmantel, aber damit beschäftigt, den Gatten und die Kinder gut versorgt in den Tag zu entlassen. Glücklich scheint sie dabei nicht zu sein. Zu den 70ern und frühen 80ern könnte es durchaus noch passen und somit auch zum Buchinhalt und zur Familie Schönwald.
Ein Wochenende in Berlin, der queere Buchladen von Karolin Schönwald soll eröffnet werden und die Eröffnung wird gestört durch junge Leute, die Farbbeutel werfen und die Finanzierung des Ladens mit Nazigeld in Verbindung bringen. Der erste Hinweis darauf, dass die Familie einiges einfach übergangen, verschwiegen haben könnte.
Die Familie besteht aus den Eltern Ruth und Harry, beide deutlich über 70, gut situiert und wohnhaft in Köln und drei erwachsenen Kindern. Der älteste Sohn Chris hat den Traum der Mutter verwirklich und lehrt Literatur an der Columbia University – so zumindest der letzte Wissensstand der Familie. Seine Partnerinnen wechseln, aktuell ist es Kimberley.
Karolin hat Kunstgeschichte studiert, war kurzzeitig verheiratet, um sich nach 4 Monaten wieder scheiden zu lassen und hat sich endlich dazu entschlossen, unter die Buchhändler zu gehen. Sie lebt in einer lesbischen Beziehung.
Benni, das Nesthäkchen, ist verheiratet und hat zwei Kinder und ein Haus in der Uckermark. Wovon er lebt, weiß eigentlich niemand, aber seine Frau Emilia ist ausgesprochen betucht, aber auch ziemlich schwierig. So sieht es zumindest ihre Schwiegermutter.
Die Eltern und hier vor allem Ruth haben Probleme mit ihren Schwiegertöchtern, wobei es letztlich darauf hinausläuft, dass sie auch Probleme mit sich selbst haben, diese aber immer unter den Teppich gekehrt haben. Ruth hätte so gern mehr aus ihrem Leben gemacht.
Ich als Leser habe im Verlauf des Buches immer wieder meinen Eindruck revidieren müssen. War ich am Anfang noch sehr bei Ruth und habe durchaus zugestimmt, dass nicht jeder Aspekt einer Sache unbedingt ausdiskutiert werden muss, so konnte ich im Verlauf des Buches auch die anderen Protagonisten immer besser verstehen. Die Intention des Autors, das Wochenende und wie es dazu kam, nicht nur aus einer Sicht zu erzählen sondern aus der fast aller Beteiligten, hilft dabei, auch die Beweggründe der anderen zu verstehen. Und für mich war das große Thema, das über allem stand:
Ehrlichkeit, Offenheit und Authentizität.
Das allerdings erzwingen zu wollen, wie es die sogenannten Instagram-Kids tun, kann auch nicht die Lösung sein.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Der 1974 geborene Autor und Journalist Philipp Oehmke legt nach seinem beachtlichen biografischen Debüt über Die Toten Hosen seinen ersten Roman Schönwald im Piper - Verlag vor und um es vornweg zu sagen : es ist ein grossartiger Roman geworden, unterhaltsam, tiefgründig und …
Mehr
Der 1974 geborene Autor und Journalist Philipp Oehmke legt nach seinem beachtlichen biografischen Debüt über Die Toten Hosen seinen ersten Roman Schönwald im Piper - Verlag vor und um es vornweg zu sagen : es ist ein grossartiger Roman geworden, unterhaltsam, tiefgründig und voller Esprit.
Die Schönwalds - was für ein Kaleidoskop einer Familie : Die Eltern aus Köln, wohlhabend, beide Ende siebzig und eigenwillig wie ihre Kinder auch.
Der Vater, ein ehemaliger Oberstaatsanwalt, der auf seine Art gutmütig und herrlich rückständig ist im Kampf gegen die Tücken der sich zunehmend technisierenden Gesellschaft und der seine Ehe durch den heimlichen Besuch bei eine privat finanzierten Psychotherapeutin zu begreifen versucht.
Ruth, seine intellektuelle Ehefrau, als Studentin ZEIT-Abonnentin und später beinahe Professorin und nun beseelt davon, alle möglichen Konflikte (und in den wenigen Tagen, in denen der Roman spielt, kommen eine Menge davon auf sie zu) klein zureden und mit aller Kraft zu ignorieren. Müssig darüber zu berichten, wie es um die emotionalen Bindungen zu ihren Kindern bestellt ist.
Das Paar und ihre drei Kinder treffen zur Eröffnung eines Buchladens ihrer mittleren (vielleicht lesbischen ?) Tochter Karolin in Berlin-Kreuzberg zusammen, irritiert durch einen schwerwiegenden Vorfall in den Stunden der Eröffnung.
Karolin hat eine schwierige Suche nach ihrer Identität hinter sich, war schon einmal verheiratet, jedoch alsbald wieder geschieden, was auch auf ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit zurückzuführen ist. Letztlich ist sie es auch, die einem weiteren dunkeln Familiengeheimnis auf die Spur kommt, an welchem sie indirekt beteiligt war.
Trost konnte ihr oft ihr grosser Bruder Chris spenden, ein erfolgreicher linker Literaturprofessor in New York, welchem jedoch fristlos gekündigt wurde und der sich gegen seine eigentliche Überzeugung einer zu den amerikanischen Rechtsradikalen zählenden propagandistischen Trump-Befürworter-Organisation angeschlossen hat und von dieser auch fürstlich entlohnt wird.
Diese abenteuerliche Entwicklung jedoch konnte er bislang erfolgreich vor seiner Familie in Deutschland geheimhalten und er tut vieles dafür, dass dies auch so bleibt.
Erst im vorletzten der dreizehn Kapitel erfährt der Leser den Grund seiner Kündigung, indem sich ein weiterer Kreis des Romans eindrucksvoll schliesst.
Eines seiner wunderbaren charakteristischen Merkmale ist sein intellektuelles Ironie-Tourette.
Und schliesslich ist da noch Benni, verheiratet mit Emilia und Vater von zwei behüteten Jungs, selbst Nachzügler und hochbegabt, was seinen beruflichen Werdegang betrifft, doch im Umgang mit seiner Frau (die zu den Schönwalds eine sehr kritische Distanz aufbringt, obschon sie selbst in verwöhnten Verhältnissen aufgezogen wurde) legt sich ein düsterer Schatten auf seine Seele, die ihn zu unflätigen verbalen Beleidigungen treiben, die nicht nur die vermeintliche Idylle ihres Anwesens in Brandenburg zerstören.
Kann ein vergleichsweise junger Autor eine Geschichte schreiben, die über mehrere Generationen in die jüngere Vergangenheit zurückreicht und deren unausgesprochene Nichtbewältigung die Familie in der Gegenwart konfliktreich einholt ?
Ja - er kann, weil Oehmke ein intelligenter Erzähler und gut reflektierender Betrachter von Vergangenheit und Gegenwart ist und seine Figuren bis in die Nebenrollen differenziert anlegt, ohne sie zu diffamieren.
Dabei erzählt er geistreich und detailreich und beschert jedesmal Freude, den über 500 Seiten Roman zur Hand zu nehmen und weiterzulesen.
Die Kinder bleiben die Kinder ihrer Eltern - mit allen Vorzügen und mit allen Schwächen und - keiner ist ganz gut und keiner ist ganz schlecht.
Den Leser erwartet ein in die aktuelle zeitgeschichtliche Gegenwart eingebetteten Roman, der zugleich herausragend gute Unterhaltung verspricht und ein präzises Abbild unserer eben auch oftmals verstörenden Gesellschaft darstellt (selbst wenn er in der sogenannten Oberschicht angesiedelt ist) und der sich - wenn überhaupt solcherart Vergleiche noch erforderlich sein sollten - würdig in die Reihe der gegenwärtigen Familienromane wie Crossroads von Jonathan Franzen einreiht.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Der Roman beginnt mit der Eröffnung eines queeren Buchladens in Berlin – für die Schönwalds eigentlich ein Grund zum Feiern, doch junge Aktivisten ruinieren die Feier. Sie konfrontieren die Familie mit schweren Anschuldigungen, die nur ein Auslöser dafür sind, dass …
Mehr
Der Roman beginnt mit der Eröffnung eines queeren Buchladens in Berlin – für die Schönwalds eigentlich ein Grund zum Feiern, doch junge Aktivisten ruinieren die Feier. Sie konfrontieren die Familie mit schweren Anschuldigungen, die nur ein Auslöser dafür sind, dass ganz andere Geheimnisse ans Licht kommen.
Kapitelweise lernen wir die einzelnen Familienmitglieder näher kennen, die im Laufe der Handlung gezwungen werden, ihr Leben zu bilanzieren – zumal sie sich ernsthaft fragen müssen, wie gut sie einander überhaupt kennen. War „Never complain, never explain“ das richtige Lebensmotto? Dass der Autor zeitlich vor und zurückspringt, die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven erzählt und uns häppchenweise neue Bruchstücke und Einsichten liefert, ist dramaturgisch raffiniert und verstärkt den Eindruck, dass die Fassade immer mehr bröckelt. Auch an aktuellen Debatten und originellen Ideen mangelt es nicht, zum Beispiel die Background-Geschichte des jüngsten Sohnes Benni und wie er mit seiner Frau Emilia zusammenkommt.
Die unterschiedlichen Charaktere sind sehr gut ausgearbeitet, der Sprachstil anspruchsvoll und mit subtilem Humor angereichert. „Wir sind eine Familie mit über Generationen weitergegebenen Strukturen und Kommunikationsformen“ ist für mich ein Schlüsselsatz in diesem Roman, der eine scheinbar heile Familie entlarvend und unterhaltsam seziert.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Karolin Schönwald eröffnet im hippen Berlin 🐻🪩 eine queere Buchhandlung mit ‚einer‘ Freundin (Alina) und bei der Eröffnung kommt es zum Desaster, als ein Pulk von Menschen vor dem neuen Geschäft randaliert und die Fensterscheibe zerstört. Der Grund ist: Das …
Mehr
Karolin Schönwald eröffnet im hippen Berlin 🐻🪩 eine queere Buchhandlung mit ‚einer‘ Freundin (Alina) und bei der Eröffnung kommt es zum Desaster, als ein Pulk von Menschen vor dem neuen Geschäft randaliert und die Fensterscheibe zerstört. Der Grund ist: Das Startkapital für die Ladeneröffnung stammt aus dem Erbe von Karolins Großvater, einem verstorbenen, ehemaligen Nationalsozialisten. Neben dieser 💥Thematik greift der Roman die Familienprobleme der Schönwalds und damit etliche weitere gesellschaftliche Spannungsfelder und aktuelle Themen (u. a. Trump Kritik, umaufgearbeitete Nazi-Vergangenheit in deutschen Familien, Familienstreitereien und -konflikte, Queerness, etc.) auf und auf 543 Seiten wird dies aus den verschiedenen Perspektiven der fünf Familienmitglieder (den Eltern Harry und Ruth sowie den erwachsenen Kindern — Chris, Karolin und Benni) exerziert.
»SCHÖNWALD« von Philipp Oehmke konnte mich leider nicht überzeugen. Ich muss ehrlich sagen, dass das Buch meiner Meinung nach zu viele Seiten umfasst und diese leider nicht inhaltsstark füllt. Der Roman wollte aus meiner Sicht zu viel und die Thematiken werden mir persönlich zu oberflächlich und auch zu sprunghaft verhandelt. Abgesehen davon, konnte ich leider keine Verbindung zu den Protagonist:innen aufbauen … Das war einfach nichts mit diesem Roman und mir — aber vielleicht geht es anderen ganz anders als mir?
Von mir gibt es daher leider keine Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Never complain, never explain!
„Niemals klagen, niemals erklären“ – nach diesem Maßstab wurde Ruth Schönwald erzogen und diese Maßgabe hat sie auch in ihrem Leben durchgezogen – im Verhältnis zu ihrem Mann, ihren Kindern und Enkeln. Dass dadurch …
Mehr
Never complain, never explain!
„Niemals klagen, niemals erklären“ – nach diesem Maßstab wurde Ruth Schönwald erzogen und diese Maßgabe hat sie auch in ihrem Leben durchgezogen – im Verhältnis zu ihrem Mann, ihren Kindern und Enkeln. Dass dadurch schon mal etwas unter den Tisch gekehrt wurde, ist ganz logisch.
Doch Ruth, eine der Hauptfiguren in Philipp Oehmkes Gesellschaftsroman „Schönwald“ lebt nach dem Motto: „Informationsmanagement war ihrer Ansicht nach Teil einer vernunftbegabten Zivilisation. Wenn jeder Mensch alles, was er dachte, alles, was er erlebte, mit jenen teilte, die ihm oder ihr am wichtigsten waren […], wären Schmerz und Leid allerorten. Ständig wäre man nicht nachvollziehbaren oder verletzenden Aktionen anderer ausgesetzt, und umgekehrt. Nicht alle der eigenen Handlungen waren anderen erklärbar. Dafür war der Mensch in all seinen externen Verstrickungen zu komplex.“ (s. 434)
Auch andere Figuren dieser Familiengeschichte möchten sich nicht erklären, wie z.B. Chris Schönwald, der älteste Sohn, der vom linksliberalen US-Linguistikprofessor zum Trump-Fürsprecher geworden ist, nachdem er seinen Posten verloren hat.
Oehmkes Roman wird als „kluger Blick auf unsere gesellschaftliche Gegenwart“ beschrieben – und viele der gegenwärtigen Diskussionen um LGBTQ, „kweer“, „Migrationshintergrund“, „wokeness“, Literatur, Nazivergangenheit und vieles mehr finden ihren Platz.
Mich hat der Einstieg mit dem „Nazigeld“, das den queeren Buchladen der Tochter der Schönwalds finanziert, allerdings auf eine falsche Fährte geführt – ich hatte mehr zu diesem Thema erwartet. Vor allem, weil in der Anlage der Diskussion im Buch auch die These mitschwingt, dass jede:r Deutsche ohne „Migrationshintergrund“ ja einen „Nazihintergrund“ haben müsse.
In „Schönwald“ gibt es viele spannende Themen, die Perspektivwechsel in der Erzählung haben eine eigene Dynamik entfaltet, die Personen allerdings nicht alle die nötige Tiefe erhalten. Einige Passagen bleiben auch unerklärlich – vielleicht wäre weniger thematische Vielfalt doch mehr gewesen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Einbindung des Hosen-Konzerts finden soll: Überflüssig oder faszinierend, dass Oehmke, der ja eine Tote-Hosen-Biografie geschrieben hat, sein Sujet auch in diesem Roman einen Platz gibt?
Mir hat die Lektüre von „Schönwald“ auf jeden Fall gefallen – insbesondere der Aspekt der Kommunikation oder Nichtkommunikation, das Vorhandensein von Geheimnissen zwischen den vertrauten Personen hat mich immer wieder zum Nachdenken angeregt. Stil und Thematik von „Schönwald“ machen den Roman für mich zu einer eindeutigen Leseempfehlung. Da kann man auch über einige logische Schwächen, kleinere Wiederholungen und Tippfehler hinwegsehen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Schönwald
Philipp Oehmke hat einen wunderbarer Roman über eine komplizierte Familie und ihre fehlende Kommunikation geschrieben.
Die Familie Schönwald hütet Geheimnisse.
Chris, der liberale Linguistik-Professor, in den USA erfolgreich, erhält eine Kündigung der …
Mehr
Schönwald
Philipp Oehmke hat einen wunderbarer Roman über eine komplizierte Familie und ihre fehlende Kommunikation geschrieben.
Die Familie Schönwald hütet Geheimnisse.
Chris, der liberale Linguistik-Professor, in den USA erfolgreich, erhält eine Kündigung der Uni und wechselt ins rechte politische Lager der Trump-Anhänger, die selbst ein Jahr nach der „gestohlenen“ Wahl weiterhin ihre Mythen pflegen und an dem Sieg der nächsten Wahl arbeiten.
Seine Schwester eröffnet in Berlin einen queeren Buchladen. Bei der Eröffnung des Buchladens kommt es zu Angriffen junger Internet-Aktivist:innen, die die Herkunft des Startkapitals für den Buchladen hinterfragen. Ist das Geld des Großvaters „Nazi-Geld“?
Karolins sexuelle Orientierung scheint etwas „unklar“ in der Familie zu sein. Aber es fragt auch niemand nach.
Der Bruder Ben lebt mit Frau (die auch an ihren eigenen Kindheitstraumata als Tochter eines Milliardärs, der sie nicht beachtet hat) und Kindern in Brandenburg. Der hochintelligente Mann, der die Studiengänge Mathematik und Jura gleichzeitig erfolgreich absolviert hat, leidet unter Zwangsstörungen
Die Eltern Ruth und ihr Ehemann Harry haben sich auch nicht mehr viel zu sagen. Ruth blickt auf eine gescheiterte Karriere als Germanistin-Professorin zurück, auf die sie wegen der Kinder verzichtet hat. Sie möchte den Schein einer perfekten Familie wahren und findet nicht, dass man nicht über alles reden muss. Harry möchte gern ergründen, ob sein Leben glücklich verlaufen ist und besucht heimlich eine Therapeutin.
Bei einem Zusammentreffen der Familie anlässlich der Eröffnung des Buchladens in Berlin kommt es zu zahlreichen Komplikationen und einige Geheimnisse werden gelüftet.
Die Charaktere dieses Romans sind unglaublich gut dargestellt, ebenso die aktuellen gesellschaftlichen Strömungen.
Thomas Mann spielt sowohl im wissenschaftlichen Schaffen der Mutter als auch in dem Roman immer wieder eine Rolle, aber auch andere Anspielungen auf Literatur und Kunst zeigen, dass der Autor ein großer Kenner der Literatur- und Kunstszene sowohl in Deutschland als auch in den USA ist. Ich bin ein wenig neidisch auf seine Freundschaft zu Campino von den Toten Hosen.
Die gesellschaftspolitische Zeit der Generationen wird spannend abgebildet (Boomer Generation - Generation X - Millennial Emos) und weckt Erinnerungen an meine eigene Zeit zwischen Boomern und Generation X.
Die personale Erzählperspektive bleibt durchgängig bei allen Familienmitgliedern erhalten und so lernen wir sie alle in ihrer Sichtweise ihrer kleinen, eigenen Sicht der Welt kennen. Hier ist sicher auch der Unterschied zur auktorialen Erzählperspektive eines Thomas Mann zu sehen, es gibt keine Erklärungen oder Belehrungen eines außenstehenden Beobachters, die Zerrissenheit dieser Familie, ihre Sprachlosigkeit werden nicht kommentiert. Da haben die großartigen aktuellen amerikanischen Autoren ihren Einfluss hinterlassen. Und das ist gut so.
Die grandiose Erzählkunst des Autors zeigt sich auch in der detailgenauen Beschreibung zum Beispiel der brandenburgischen Hipster-Bauernhöfe samt ihrer Bewohner (unglaublich satirisch) oder in dem Kapitel „Peshawar“, in dem es über Bennis Versuch der Überquerung des Khyber Passes geht (unglaublich traurig).
Ich bin dankbar für dieses Buch und habe es voller Germanisten-Freude gelesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Wie in so vielen anderen deutschen Familien wird auch bei den Schönwalds gerne die Vergangenheit verschwiegen. Ruth, die Mutter sieht das ganz genauso. Statt mit der Vergangenheit aufzuräumen, achtet sie penibel auf die feine Fassade und hat dies in ihrem Leben perfektioniert. Die drei …
Mehr
Wie in so vielen anderen deutschen Familien wird auch bei den Schönwalds gerne die Vergangenheit verschwiegen. Ruth, die Mutter sieht das ganz genauso. Statt mit der Vergangenheit aufzuräumen, achtet sie penibel auf die feine Fassade und hat dies in ihrem Leben perfektioniert. Die drei Kinder Chris, Karolin und Benni waren ihr Lebensinhalt. Alle drei haben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe gewählt.
Chris mit seinem Leben in den USA, das zwar Geld bringt, aber nicht seiner eigentlichen Gesinnung entspricht. Karolin mit ihrem queeren Buchladen in Berlin. Und Benni, der ein normales Familienleben mit Frau und Kindern führt.
Der Leser taucht ein in all diese Leben, erfährt über jeden die Hintergründe, die Fäden, die alles verbinden.
Diese Hintergründe, die sich nach und nach eröffnen wie ein Puzzle machen das Buch zu einer Lesefreude. Der flüssige Schreibstil lässt mich durch die Seiten fliegen und ich kann dem Geschehen sehr gut folgen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ich habe das Buch von Anfang an genossen. Ein ganz tolles Buch. 5 Sterne. Absolute Leseempfehlung, auch toll als Geschenk, da es für jedermann ein Klasse Buch ist. Freue mich auf das nächste Buch des Autors!
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für