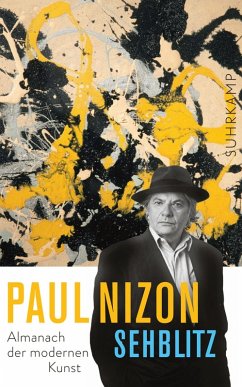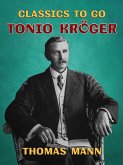Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hochaltar und Kerkerwände: Die Texte Paul Nizons zur Kunst erweisen sich im Rückblick als Schwelle, von der aus er seinem Leben eine neue Richtung gab
Als Rainer Maria Rilke im Oktober 1907 in einer Pariser Galerie vor den Zeichnungen Auguste Rodins stand, wünschte er sich die Bilder von jedem Kommentar befreit, "ohne alle Aussprache", "allein mit sich selbst". Doch schon in dem Brief, in dem er kurz darauf seiner Frau den Ausstellungsbesuch beschrieb, war die Sprache doch wieder im Spiel, "wie immer, wenn ich dem Fehler verfalle, von Kunst zu schreiben". Der Gedanke, dass Worte den Werken der bildenden Kunst nichts Wesentliches hinzufügen können, ihrer Wirkung vielleicht gar schaden, hatte zu Rilkes Zeit bereits eine lange Tradition.
Ein vollkommenes Kunstwerk, so das Argument, müsse sich selbst genügen, jede Angewiesenheit auf die Vermittlung durch Sprache sei bereits ein Beweis seiner Unvollkommenheit. Vielleicht haben sich tatsächlich viele Autoren an dieses Schreibverbot gehalten - wir wissen dann aber nichts vor ihnen, denn sie sind vor den Bildern konsequent verstummt. Rilke selbst hat sein Schweigegebot bekanntlich gebrochen und auf diese Weise einige der eindrücklichsten Bildbeschreibungen der Literatur hinterlassen. Zahlreiche andere Schriftsteller gingen ihm darin voraus, zahlreiche andere folgten ihm.
Im Fall des Schweizer Schriftstellers Paul Nizon verhielt es sich ein wenig anders: Das professionelle Schreiben über Kunst ging der literarischen Karriere voraus, nicht umgekehrt. Bevor Nizon 1961 von einer Dienstreise für die "Neue Zürcher Zeitung" nicht zurückkehrte, um fortan als Schriftsteller zu leben, war er acht Monate lang deren leitender Kunstredakteur gewesen und hatte zuvor in Bern mit einer kunsthistorischen Arbeit über die Briefe Vincent van Goghs promoviert.
Seine Kritiken zur Kunst der Moderne fallen größtenteils in die Jahre, in denen Nizon noch zögerte, seine Existenz ganz auf das literarische Schreiben zu gründen. Im Vorwort zu den nun in einer Auswahl neu erschienenen Kritiken beschreibt Nizon sie jedoch zu Recht als "Teil meines literarischen Werdegangs".
Die Lektüre beginnt mit einer Enttäuschung. Die einleitenden Texte zu Francisco de Goya und William Turner sind auf eine Weise klischeehaft, dass man sich fragt, ob ihr Verfasser tatsächlich mit dem Autor der übrigen Texte des Bandes identisch ist. Kein Allgemeinplatz des Geniekults wird ausgelassen, die Sprache ist eigentümlich flach. Aber schon im folgenden Beitrag über den französischen Maler Henri Rousseau findet Nizon zu einer eigenen Diktion. Im Klischee des malenden Zollbeamten und naiven Volkskünstlers erkennt er die Hilflosigkeit eines Publikums, das die Bilder Rousseaus keiner bekannten Kunstrichtung zuordnen konnte. Statt Produkte eines naiven Volkskünstlers seien die üppigen Dschungellandschaften mit ihren "verlassenen Puppen, Hüllen und Seelenbehältern" vielmehr das Resultat bewusster künstlerischer Entscheidungen.
In Ferdinand Hodler sieht Nizon den seltenen Fall eines Schweizer Nationalmalers, der jedem Versuch widerstanden habe, das Land "heimelig" und dadurch "weltunähnlich" zu machen. Nizon begründet das mit Hodlers Darstellung der Schweizer Bergwelt - "ein Tabu erster Ordnung". Denn in der Schweiz seien die Berge der "nationale Hochaltar" des Landes, zugleich aber auch die "Kerkerwände unserer Enge". In Hodlers Berglandschaften erkennt Nizon statt traulicher Folklore und mystischer Verklärung das Gepresste und Geschichtete einer geologischen Formation: eine "Grimasse der Zeit". Immer wieder lassen einen solche Formulierungen aufmerken. Mirós Kompositionen nennt Nizon "quecksilbrig", Jackson Pollocks abstrakte Bilder erscheinen ihm "wie Gefuchtel von Totengebein oder Leichenfingern", angesichts der voluminösen Skulpturen Aristide Maillols notiert er: "Die Luft wird dünn neben ihnen."
Zu manchen der Texte hätte man gerne eine begleitende Abbildung gesehen, zumal Nizon auch über Atelierbesuche bei Schweizer Künstlern berichtet, deren Werke heute kaum mehr jemand kennt. Aber der Verlag bleibt bei der Tradition, die der Kulturhistoriker Philipp Felsch einmal als "Suhrkamps Ikonoklasmus" beschrieben hat: Es zählt allein das geschriebene Wort, der Text bleibt bilderfrei, "so nüchtern wie eine protestantische Kirche".
Mit den neueren Entwicklungen der Kunst, mit Pop-Art, Environment oder Happening, konnte Nizon nicht viel anfangen. Auf der Venedig-Biennale 1968 beschäftigt ihn das martialische Auftreten des italienischen Militärs weitaus mehr als die ausgestellten Werke, die "Art Basel 71" interessiert ihn vor allem aufgrund des unverhohlen ausgestellten Warencharakters der Exponate. Auch durch die von seinem Studienkollegen Harald Szeemann in Bern kuratierten Ausstellungen schlendert er als aufmerksamer, aber distanzierter Betrachter: "Flucht aus dem Kunstwerk in die Demonstration", lautet sein Urteil.
Nizon registriert hier einen Trend zum "agitierenden Werktypus", ist aber klug genug, ihn nicht einfach als Verfallssymptom zu verurteilen. Der Wille zur Provokation interessiert ihn als zeitgeschichtliches Phänomen, die künstlerischen Resultate hingegen affizieren ihn nicht.
In seinem Journal "Die Erstausgaben der Gefühle" formuliert Nizon 1968 eine "Erzählidee": "Von der Beschreibung eines Bildes oder einer fremden anschaulichen Szene ausgehen und allmählich in ein eigenes Erlebnis übergehen, aber so, daß das eine in das andere unmerklich verschwimmt." Als Nizon seine Kunstkritiken schrieb, stand ihm dieser Schritt "aus dem Bild in ein Eigenes" noch bevor. Die nun wieder vorliegenden Texte zur Kunst erweisen sich im Rückblick als Schwelle, von der aus Nizon den Weg in die Dichtung antrat.
In einem der späteren Romane lässt Nizon seine Hauptfigur in Bern eine Ausstellung des russischen Malers Chaim Soutine besuchen. Die Begegnung mit den Bildern beeindruckt den Romanhelden so sehr, dass er später Kunstgeschichte studiert und eine Doktorarbeit über die Briefe Vincent van Goghs beginnt. Die Beschreibung der Bilder Soutines im Roman erinnert dabei an einen Text, den Nizon Jahre zuvor in der Rolle des Kunstkritikers geschrieben hatte - und es ist schwer zu entscheiden, ob hier ein Schriftsteller nachträglich von einem Kritiker abschreibt, der er selbst einmal gewesen ist, oder ob der Kritiker von damals bereits der angehende Romanschriftsteller war.
PETER GEIMER
Paul Nizon: "Sehblitz".
Almanach der modernen Kunst.
Hrsg. von Pino Dietiker
und Konrad Tobler.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 304 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH