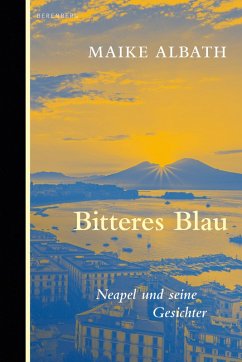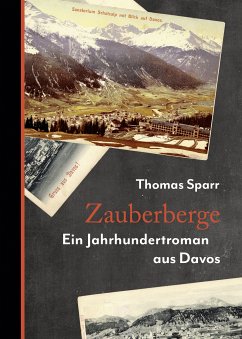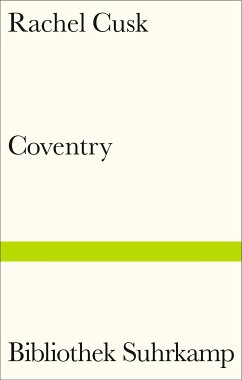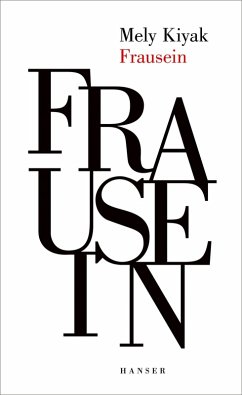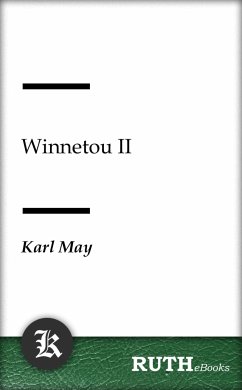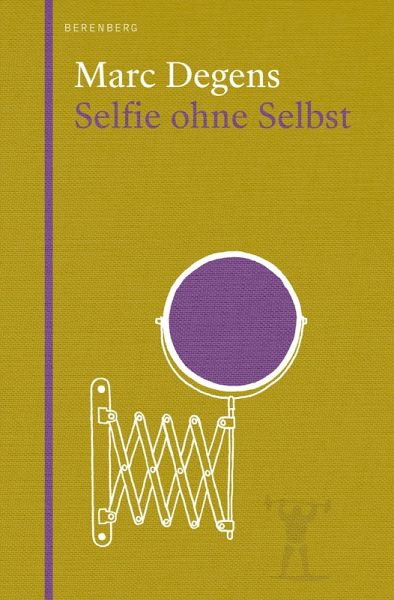
Selfie ohne Selbst (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,00 €**
13,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dass Herr Rutschky in seinen Tagebüchern nicht über Susan Sontag schreibt, sondern über ihn, und nicht einmal schmeichelhaft, das ist für Marc Degens Ausgangspunkt für ein virtuoses Stück Autofiktion. Sein Bericht über ein Stück höfische Kultur im 21. Jahrhundert und was sie anrichten kann, hat es in sich. Wie das eigene Leben von den hierarchischen Zufällen in einem eifersüchtig umtanzten Intellektuellen-Zirkel hin und her geworfen wird und welche Kollateralschäden dabei drohen, diese überaus ernsthafte komische Geschichte wurde so noch nie erzählt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.