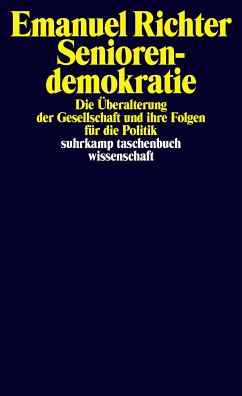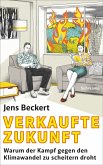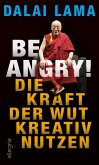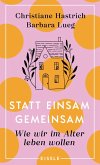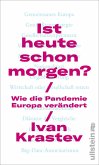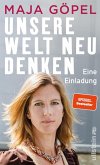Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Im Sinne des Gemeinwohls: Emanuel Richter träumt von einer Seniorendemokratie
Was soll das sein, jene "Seniorendemokratie", die der Autor, ein im Ruhestand befindlicher Politik-Professor aus Aachen, mit seinem Buchtitel evoziert? Eine Herrschaft der Alten ist natürlich nicht gemeint. Das würde dem Begriff "Demokratie" widersprechen, der Volksherrschaft meint - allerdings durchaus mit bestimmten Altersqualifikationen, etwa beim aktiven und passiven Wahlrecht. Vielmehr will Emanuel Richter die Älteren in der Gesellschaft politisch aktivieren, als eine Art Partizipations-Ressource für die "Laiendemokratie". Und dies nicht nur, damit die Senioren ihre eigenen Interessen in der politischen Arena artikulieren und durchsetzen können, sondern damit sie im allgemeinen Interesse handeln und das Gemeinwohl befördern.
Um das zu begründen, breitet Richter auf den ersten hundertachtzig von zweihundertfünfzig Seiten seines Buches statistisches Material aus. Da spricht allerdings wenig für die Seniorendemokratie als realistische Option moderner Gesellschaften. Zunächst trägt der Autor die Fakten zur "Überalterung der Weltgesellschaft" (was derart pauschal nicht stimmt) und insbesondere Deutschlands vor. Was das bedeutet, etwa für die Rentenversicherung, und wo der Autor politisch steht, wird mit Formulierungen wie der vom "neoliberal erzwungenen Wandel des Wohlfahrtsstaates . . . weg von Anspruchshaltungen, hin zum Nachweis von Bedürftigkeit" angedeutet. Richter hat den Eindruck, dass der "Ruhestand" immer stärker von Forderungen unterlaufen werde, die Senioren sollten ihre Arbeitsfähigkeit erhalten oder wiederherstellen, damit ein im Wortsinn "produktives Altern" ermöglicht werde. Das dient in seiner Sicht der Entlastung des "erschöpften Wohlfahrtsstaates": "Arbeiten und Konsumieren bis zum Tode", fasst Richter dieses vermeintliche Programm in einer seiner Überschriften zusammen - das darf man eine unterkomplexe Analyse der finanziellen Probleme des Sozialstaates und der Lage der Rentner nennen.
Dem Autor entgeht nicht, dass die oft beschworene Spaltung der Gesellschaft sich unter den Senioren fortsetzt, ja in dieser Gruppe sogar noch verschärft: Auf der einen Seite gibt es die kulturell und materiell gut gestellten "High Income"-Rentner, auf der anderen diejenigen, insbesondere alleinstehende Frauen und Migranten, die kaum ein Auskommen haben und deshalb dazuverdienen müssen. Ein Menetekel für die "Seniorendemokratie" ist dabei, dass die vermögenden Älteren im Gegensatz zu den ärmeren diejenigen sind, die sich für ein Engagement im gesellschaftlichen und politischen Leben am leichtesten gewinnen lassen (was im übrigen auch für andere Alterskohorten gilt).
Ausführlich lässt Richter dann Altersbilder aus Vergangenheit und Gegenwart Revue passieren - von Plato bis Christine Westermann. Das gegenwärtige Altersbild zeichnet sich seiner Meinung nach durch eine Mischung aus "Jugendkult und Selbstoptimierung" aus. Darunter fallen für den Autor auch Aktivitäten, die medizinisch nicht nur sinnvoll sind, sondern sogar geboten sein können. All das wird letztlich als eine "Strategie wohlfahrtsstaatlicher Entlastung" angesehen, sogar Selbsthilfe-Gruppen von Senioren finden keine Gnade vor den Augen des Autors.
Das ändert sich im letzten Teil des Buches unter der Bedingung, das Richter solche Aktivitäten mit dem Etikett "politische Partizipation" versehen kann. Absurd mutet an, was da auf den verbleibenden siebzig Seiten den Senioren mit dem Ziel der "Stärkung einer solidarischen Bürgerbeteiligung" empfohlen wird, das Schlagwort Richters dafür heißt: "Demokratie statt Demenz als politisches Programm". Wer als älterer Mensch partizipationsintensiv lebt, so könnte man das parodistisch zuspitzen, der kann es sich ersparen, zu joggen oder in die Muckibude zu gehen, denn als "gesundheitsfördernde Handlungsperspektive" eröffnet sich ihm die politische Partizipation.
Was da vom Autor als Innovation vorgestellt wird, schlägt allerdings schnell in Bekanntes um, wenn man die Vorschläge und Beispiele betrachtet, die laut Richter die ausgerufene Seniorendemokratie fördern sollten: Das reicht vom Ausbau bereits längst bestehender Beteiligungsformen wie etwa Seniorenbeiräten bis hin zum Engagement in vornehmlich "kleinräumigen" Bürgerinitiativen, für das die Rentner-Generation natürlich mehr Zeit hat als die beruflich noch Aktiven. Verbunden ist das mit der Forderung nach mehr direkter Demokratie und Laienpolitik.
Damit auch die materiell und kulturell schlechter gestellten Senioren und Migranten dabei mittun können, muss das jedoch nach Meinung des Autors trainiert werden, etwa in Seminaren (da tut sich für Politik-Professoren im Ruhestand ein weites Betätigungsfeld auf); außerdem sei es nur möglich mit Hilfe von "wohlfahrtsstaatlichen Ersatzleistungen, . . . die nicht mehr aus den Rententöpfen zu bedienen sind". Genaueres über die Finanzierung erspart sich der Autor jedoch. Eine kurz hingeworfene Bemerkung über eine konfiskatorische Erbschaftsteuer deutet allerdings wenigstens an, wo das Geld herkommen soll. Was dazu wohl die besonders partizipationswilligen "High Income"Senioren sagen werden?
Wer auf die im Untertitel des Buches versprochene Analyse politischer Folgen der Überalterung unserer Gesellschaft gehofft hatte, wird bitter enttäuscht. Emanuel Richters Vorstellungen von einer "Seniorendemokratie" können diese Frustration nicht lindern.
GÜNTHER NONNENMACHER
Emanuel Richter:
"Seniorendemokratie".
Die Überalterung der
Gesellschaft und ihre
Folgen für die Politik.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 261 S., br., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main