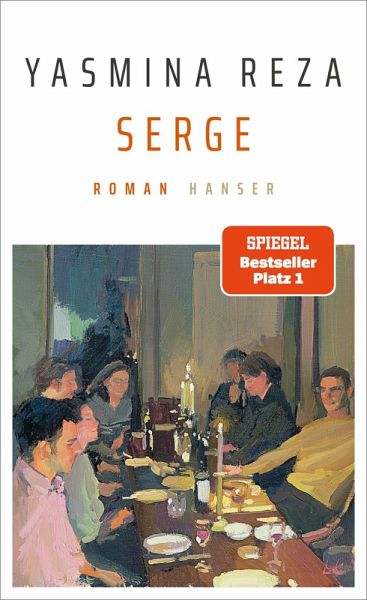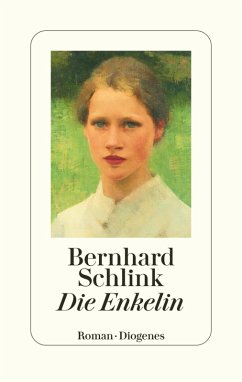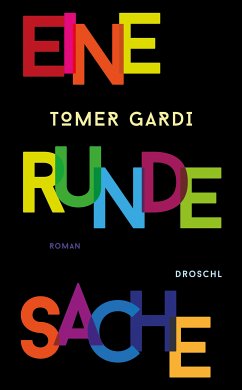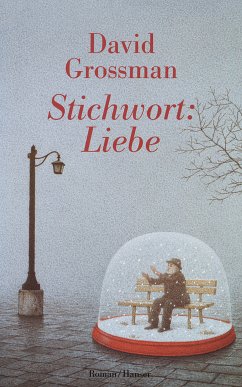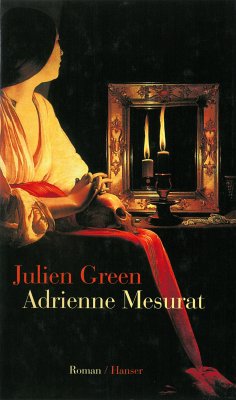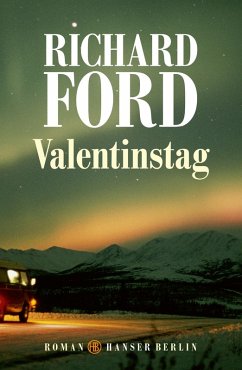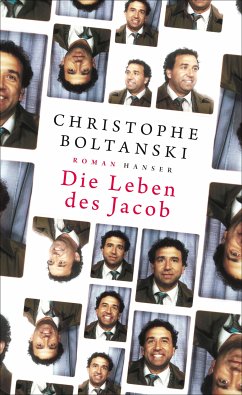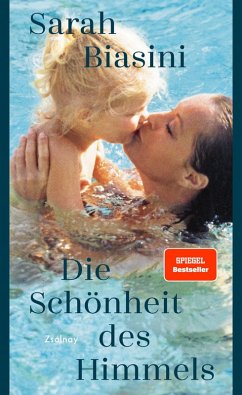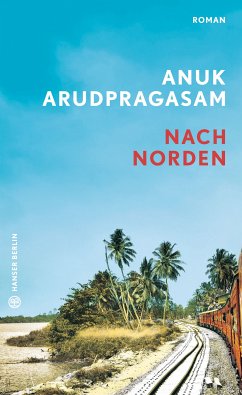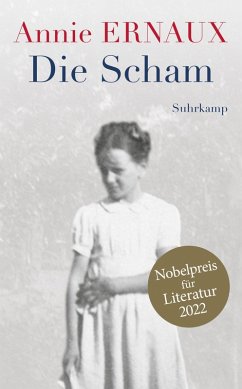Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Was bedeutet Familie? Was heißt jüdisch sein? Der neue Roman von Jasmina Reza kreist um große Fragen - bissig, zärtlich und herzzerreißend komisch. Die Geschwister Popper: Serge, verkrachtes Genie und homme à femmes, Jean, der Vermittler und Ich-Erzähler, und Nana, die verwöhnte Jüngste mit dem unpassenden spanischen Mann. Eine jüdische Familie. Nach dem Tod der Mutter entfremdet man sich immer mehr. Zu ihren Lebzeiten hat keiner die alte Frau nach der Shoah und ihren ungarischen Vorfahren gefragt. Jetzt schlägt Serges Tochter Joséphine einen Besuch in Auschwitz vor. Virtuos hält ...
Was bedeutet Familie? Was heißt jüdisch sein? Der neue Roman von Jasmina Reza kreist um große Fragen - bissig, zärtlich und herzzerreißend komisch. Die Geschwister Popper: Serge, verkrachtes Genie und homme à femmes, Jean, der Vermittler und Ich-Erzähler, und Nana, die verwöhnte Jüngste mit dem unpassenden spanischen Mann. Eine jüdische Familie. Nach dem Tod der Mutter entfremdet man sich immer mehr. Zu ihren Lebzeiten hat keiner die alte Frau nach der Shoah und ihren ungarischen Vorfahren gefragt. Jetzt schlägt Serges Tochter Joséphine einen Besuch in Auschwitz vor. Virtuos hält Reza das Gleichgewicht zwischen Komik und Tragik, wenn bei der touristischen Besichtigung die Temperamente aufeinanderprallen. Hinter den messerscharfen Dialogen ist es gerade die existentielle Hilflosigkeit dieser Menschen, die berührt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 2.24MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
Yasmina Reza, 1959 geboren, ist Schriftstellerin, Regisseurin und Schauspielerin und die meistgespielte zeitgenössische Theaterautorin. Bei Hanser erschienen u.a. »Glücklich die Glücklichen« (Roman, 2014), »Babylon« (Roman, 2017), für den sie mit dem Prix Renaudot 2016 ausgezeichnet wurde, »Kunst« (Schauspiel, 2018), »Der Gott des Gemetzels« (Schauspiel, 2018), »Bella Figura« (Schauspiel, 2019), »Drei Mal Leben« (Schauspiel, 2019), »Anne-Marie die Schönheit« (2019), »Serge« (Roman, 2022) und »James Brown trug Lockenwickler« (Schauspiel, 2023). Für ihr Werk wurde sie zuletzt mit dem Jonathan-Swift-Preis 2020, dem Premio Malaparte 2021, dem Prix de l'Académie de Berlin 2022 und dem Prix Mondial Cino del Duca 2024 ausgezeichnet. Das Theaterstück Der Gott des Gemetzels wurde 2011 sehr erfolgreich von Roman Polanski verfilmt, hochkarätig besetzt mit Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly.
Produktdetails
- Verlag: Carl Hanser Verlag
- Seitenzahl: 208
- Erscheinungstermin: 24. Januar 2022
- Deutsch
- ISBN-13: 9783446273405
- Artikelnr.: 62945717
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Katharina Granzin fühlt sich beim Lesen bestimmter Passagen im Roman "Serge" von Yasmina Reza nicht immer wohl, wenn sie lachen muss. Denn die französische Autorin erzählt darin sowohl ironisch und sarkastisch als auch beklemmend von einer nach der Beerdigung der alten Mutter nach Auschwitz reisenden jüdischen Familie, bestehend aus drei Geschwistern und ihrem Anhang - da wären der mittlere Bruder Jean, in der Rolle des ausgleichenden und unkritischen Ich-Erzählers, der ältere Kotzbrocken-Bruder Serge und deren jüngste Schwester Nana, die als einzige glücklich verheiratet ist, erklärt Granzin. Zunächst scheint Auschwitz das Hauptthema des Buches zu sein, meint die Rezensentin, aber bald erkennt sie, dass es sich hier um eine Erzählung über Familienkonstrukte und die familiäre und jüdische Identitätsfrage handelt. Die Figuren lernt Granzin vor allem durch ihre andeutungsreichen Dialoge kennen. Ein "geistreiches Konversationsdrama in Prosaform", schließt sie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Klug, witzig und erstaunlich leicht." Novina Göhlsdorf, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10.07.22 "Ein heiterer Roman über den Besuch einer jüdischen Familie in Auschwitz: das gelingt in unserer Gegenwartsliteratur niemand so stilsicher wie Yasmina Reza. Innerfamiliäre Konflikte und welthistorische Bruchlinien ambivalent, komplex und doch unterhaltend darzustellen: Das schafft große Literatur. Bravo!" Denis Scheck, Tagesspiegel, 27.03.22 "Dieser melancholische Roman ist ein vor Lebensweisheit schimmernder Edelstein, der sich in ein ruppig ironisches Gewand gehüllt hat, und in dieser Verkleidung nur umso ergreifender. Die fabelhafte Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel und Frank Heibert geht jeden von Yasmina Rezas Schritten mit,
Mehr anzeigen
aus dem Leichten ins Schwere, aus dem Groben ins Zarte und wieder retour, und macht ein bezwingendes, idiomatisches Deutsch daraus." Eva Menasse, Der Spiegel, 12.02.22 "Ein tragikomischer, tief berührender Roman. ... Was Jasmina Reza wagt - und kann -, muss man in deutscher Sprache lange und vergeblich suchen. Einzigartig ist unter anderem ihre Fähigkeit, Sarkasmus an der Oberfläche mit tiefer Zuneigung zu ihren Figuren zu verbinden." Marin Ebel, Tages-Anzeiger, 01.02.22 "Ein prächtig abschnurrender, kompakter Gesellschaftsroman rund um eine temperamentvolle bürgerliche Familie und ihre illustren Freunde, darunter neunundneunzigjährige sterbensbereite Spaßvögel und Charakterköpfe. ... Ein defitges, zugleich leichtes und vor allem befreiendes Buch." Margarete Affenzeller, Der Standard, 27.01.22 "Wie in ihren berühmten Sprechstücken, in 'Kunst' oder 'Der Gott des Gemetzels', ist es die Meisterschaft der gestörten, lückenhaften Dialoge, der abgebrochenen und sprunghaften Rede und Gegenrede, in denen die Tragikomödie liegt. Es sind Fragmente einer Sprache der gegenseitigen Missbilligung, des Unverständnisses und der Verachtung, gefangen in der familiären Verstrickung ... ein großartiger Roman ..." Rose-Maria Gropp, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.22 "Ein grandioser Roman ... Falls man sich generell mal nicht sicher sein sollte, ob die Bücher, die man liest, gut sind, dann kann man einfach diesen neuen Roman danebenlegen, um den Unterschied zu erkennen. 'Serge' zeigt, was einen Roman ausmacht. Ist auf eine so elegante Weise böse und witzig zugleich, hält die Balance zwischen den Wünschen und den Fehlern seiner Figuren, ohne sie für eine Pointe oder eine billige Erkenntnis zu verraten." Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.01.22 "Ein großartiger, tragikomischer Roman, der von der Unmöglichkeit des Erinnerns handelt ... Ihr vielleicht bester Roman." Iris Radisch, Die Zeit, 20.01.22
Schließen
Gebundenes Buch
Was bedeutet Familie heute?
„Ich weiß gar nicht, wie wir Geschwister es geschafft haben, diese ursprüngliche Komplizenschaft zu bewahren, wir waren uns nie besonders ähnlich oder besonders nah. Geschwisterbeziehungen zerfasern, leben sich auseinander, hängen nur noch am …
Mehr
Was bedeutet Familie heute?
„Ich weiß gar nicht, wie wir Geschwister es geschafft haben, diese ursprüngliche Komplizenschaft zu bewahren, wir waren uns nie besonders ähnlich oder besonders nah. Geschwisterbeziehungen zerfasern, leben sich auseinander, hängen nur noch am seidenen Faden von Sentimentalität oder Konvention.“ (Zitat Seite 23)
Inhalt
Bis zuletzt hält Marta Popper die chaotische Familie zusammen, zum sonntäglichen Mittagessen haben sich alle einzufinden, ihre Kinder und Enkelkinder. Serge, sechzig Jahre alt und der älteste Sohn, Jean, immer noch das mittlere Kind und Nana, die Tochter und jüngste der drei Geschwister. Nun ist Marta tot und nach dem Begräbnis teilt Joséphine, Serges Tochter, ihrem Vater mit, dass sie nach Auschwitz fahren will, auf der Suche nach der Geschichte der ungarischen Verwandten, über die Marta nie gesprochen hatte. Serge soll seine Tochter begleiten, Nana will ebenfalls mitfahren und so kommt auch Jean mit. Doch statt die Geschwister zu einen, brechen auf dieser Reise lang unterdrückte Konflikte auf.
Thema und Genre
In diesem Generationen- und Familienroman geht es um moderne Beziehungsgefüge, Alltagskonflikte unserer Zeit und Kritik an der touristischen Gedenkkultur am Beispiel Auschwitz. Kernthemen sind familiäre Bindungen, Patchworkstrukturen, Alter, Krankheit, Tod.
Charaktere
Jean, Experte für Materialleitfähigkeit, ist das typische mittlere Kind und der Vermittler zwischen Serge und Nana, denn Familie ist für ihn wichtig, obwohl oder gerade weil er keine eigene Familie will. Serge ist der kreative Lebenskünstler und Frauenheld und beide, Serge und Jean, pflegen seit Jahren ihre Vorurteile gegenüber Ramos, Franzose mit spanischen Wurzeln, Nanas Ehemann. Es ist eine weit verzweigte Großfamilie mit eigenwilligen Charakteren, die alle Facetten der menschlichen Eigenheiten zeigen.
Handlung und Schreibstil
Dieser Roman besteht aus Momentaufnahmen, kurzen Episoden in der Gegenwart, unterbrochen von Erinnerungen und Fragmenten. Es sind die Dialoge, welche die Geschichte tragen, denn hier treten die Konflikte auf, zeigt sich die Problematik, die Suche der einzelnen Figuren, ihre Alltag zu bewältigen. Man diskutiert heftig, wirft Sätze, Meinungen und Themen durcheinander und Jean, der Ich-Erzähler, ergänzt mit vielen eigenen Gedanken, Überlegungen und auch Schilderungen des Umfeldes. Die Sprache ist leicht, flüssig zu lesen, die „herzzerreißende Komik“, von der der Klappentext spricht, blieb mir mit Ausnahme einiger skurril-witziger Szenen allerdings verborgen.
Fazit
Eine Mischung aus Familien-, Generationen- und Beziehungsroman, in dem es um Alltagsprobleme und Konflikte unserer Zeit geht.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Die Geschwister Popper in der Gedenkstätte Auschwitz/Birkenau. Mit eher gemäßigtem Enthusiasmus. Serge, der Älteste, ist eigentlich nur da, weil er dazu verdonnert wurde, seine erwachsene Tochter Joséphine zu begleiten, die sich nach dem Tod ihrer Großmutter …
Mehr
Die Geschwister Popper in der Gedenkstätte Auschwitz/Birkenau. Mit eher gemäßigtem Enthusiasmus. Serge, der Älteste, ist eigentlich nur da, weil er dazu verdonnert wurde, seine erwachsene Tochter Joséphine zu begleiten, die sich nach dem Tod ihrer Großmutter für ihre jüdischen Wurzeln und den Ort, an dem Vorfahren von ihr umgebracht wurden, interessiert – ein Thema, das die Popper-Geschwister nie weiter beschäftigt hat. Weswegen Nana, die jüngste, beschließt, dass sie auch mitfahren sollte, jetzt, wo es zu spät ist, die Mutter zu befragen. Und wo Serge und Nana zusammen sind, da ist es besser, wenn auch Jean, der Ich-Erzähler, dabei ist, ein ausgleichender Puffer zwischen den beiden. Aber die Reise entwickelt sich schnell zu einem Desaster. Vor der Kulisse Auschwitz’ wo eine der schlimmsten Tragödien der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, kollidieren die ungleichen Wesen der Drei derart, dass eine Kluft entsteht, die nur von einem Ereignis wieder überbrückt werden kann, das auf gewisse Weise den Kreis zu Auschwitz schließt.
Ich kannte Yasmina Reza bisher nur durch zwei oder drei ihrer Theaterstücke, allem voran „Kunst“ (unvergessen die großartige Inszenierung mit Ulrich Tukur, Christian Redl und Dominique Horwitz), in dem drei Freunde über den Kauf eines weißen Bildes existentiell aneinander geraten. „Serge“ ist in gewisser Weise eine Variation von „Kunst“ auf einer fortgeschritteneren Ebene. Denn es ist nun mal ein Unterschied, ob sich eine Krise an einem Bild oder an einem Vernichtungslager entzündet. Die Absurdität der Situation ist eine ganz andere, denn über ein Gemälde können wir lachen, über Gaskammern nicht. Und so sind wir als Leser/Zuhörer bei „Serge“ in der Klemme. Wo wir uns bei „Kunst“ über den Streit der Freunde und den Spiegel, den sie uns vorhalten, ungeniert amüsieren können, sind wir bei „Serge“ der Unangemessenheit der Situation ausgeliefert. Die ständige Ambivalenz des Menschen zwischen den eigenen Sorgen und Nöten in der Relation zu all dem, was viel schlimmer und grausamer ist, wird hier auf die Spitze getrieben. Und das ist genial.
Genial ist auch Rezas Stil. Besonders die Dialoge sind einfach nur eine Freude, sie kann nicht verheimlichen, dass sie vom Schauspiel kommt. Was ich auch sehr an ihr schätze ist, dass sie nie vorhersehbar ist. Mann kann die Reaktion ihrer Figuren nicht vorhersagen, wird immer wieder von der Absurdität überrascht.
Gelesen wird die Hörbuchversion von „Serge“ von Peter Jordan. Er macht seine Sache sehr gut, gibt den Charakteren Form und Individualismus, jedem seine ganz klare, eigene Stimme, die viel vom Wesen offen legt. Aber er tut das - und deswegen kommt mein Lob ein wenig zögerlich - eben in seiner Auslegung. Und das liegt ja auch in der Natur der Sache, ein guter Vorleser bringt seine eigene Lesart immer mit ein. Nur war für mich seine Interpretation nicht immer stimmig. Besonders bei Nana, die Jordan sehr weinerlich anlegt, habe ich in meinem Kopf die Sätze öfter in einem anderen Tonfall wiederholt, weil es dann für mich passender wurde. Jordans Serge habe ich nicht richtig zu fassen bekommen, immer wieder hat sich mein Bild von ihm umgeformt. Doch trotz dieser Kritik ist Jordan ein Vorleser, zu dessen Einspielungen ich immer wieder greifen würde.
Die Bewertungen für „Serge“, die ich mir angesehen habe, waren nicht durchgehend positiv und ich kann einige der Kritiken durchaus nachvollziehen. Wer erwartet, dass der Roman tief in die Problematik des Jüdischseins eintaucht und sich ein ausgefeiltes Psychogramm der Protagonisten wünscht, wird nicht auf seine Kosten kommen. Für mich war das Buch weniger eine Geschichte über Nachfahren von Holocaustüberlebenden, als eine Reflexion des Lesers/Zuhörers in seiner ewigen Unfähigkeit zu kommunizieren, und nicht immer in erster Linie um sich selbst zu kreisen. Über den Menschen an sich in der Balance zwischen dem Recht, eigene Sorgen und Nöte auch als solche zu erleben, und der moralischen Forderung, die Relati
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein leichtes Stück über Auschwitz? Und dann noch Imre Kertesz gewidmet, dem einsamen Unbehausten, der sein Leben lang unter dem Trauma seines KZ-Aufenthalts litt?
Das hat mich irritiert, aber weil das Buch nun einmal da war, habe ich es auch gelesen.
Und siehe da: Yasmina Reza gelingt …
Mehr
Ein leichtes Stück über Auschwitz? Und dann noch Imre Kertesz gewidmet, dem einsamen Unbehausten, der sein Leben lang unter dem Trauma seines KZ-Aufenthalts litt?
Das hat mich irritiert, aber weil das Buch nun einmal da war, habe ich es auch gelesen.
Und siehe da: Yasmina Reza gelingt wirklich ein unglaublicher Spagat.
Im Mittelpunkt steht eine jüdische Familie in Paris: drei Geschwister, und der mittlere Bruder Jean ist der Ich-Erzähler. In treffsicheren Dialogen nimmt der Leser teil an ihren Kabbeleien, an ihren Streitereien, aber auch an ihren beruflichen Problemen und ihrem wirklich komplizierten Beziehungsalltag. Die Elterngeneration, die die Geschwister früher als kraftvolle Vorbilder erlebt hat, siecht dahin, wird zunehmend unselbständiger, die Alten müssen betreut und betüttelt werden – kein Gedanke mehr an frühere Pläne, kraftvoll und selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden! Noch hält die Mutter mit ihren sonntäglichen Mittagessen die Familie zusammen. Aber mit ihrem Tod verlieren die Geschwister nicht nur ihren Bezugspunkt, sondern auch die letzte Zeitzeugin ihrer Familiengeschichte der Shoa. Und so müssen sie sich neu formieren. Dazu beschließen sie, eine Reise nach Auschwitz zu machen, dem Ort, an dem die Familie ihrer Mutter ermordet worden war.
Auschwitz präsentiert sich als touristisch perfekt durchorganisiert. Die Massen pilgern von einem grausigen Anziehungspunkt zum nächsten, angetan mit Sonnenbrille und geblümten Shorts, und eigentlich fehlt – dachte ich – nur noch der Würschtlstand an einer versteckten Ecke. Die bizarre Situation wird gesteigert durch die Erinnerung an eine Klassenreise, bei der die Lehrerin angesichts dieses Massentourismus loslachen musste und nicht mehr aufhören konnte. Auch die Familie wuselt durch die „Sehenswürdigkeiten“, die einen sind interessiert, den anderen ist es zu warm, sie schwitzen, lassen ihrer schlechten Laune freien Lauf und entziehen sich der Betrachtung des Grauens. Dieser Gegensatz zwischen dem großen Vorhaben, der Familiengeschichte auf die Spur zu kommen, und der Verwirklichung bzw. dem Scheitern dieses Vorhabens hat etwas Groteskes, aber auch etwas Tragisches. Und auch die kommenden Versuche, die Familie zusammenzuhalten, haben etwas Morbides und sind von diesem Gegensatz geprägt.
Wie die Autorin den Bogen spannt zwischen dem Ernst, der diesem Ort (und auch folgenden Ereignissen) zukommen muss, und der Komik, die sich am Miteinander der Familie zeigt – das ist gekonnt. Souverän hält sie die Balance, wenn wir ihre unbeholfene, desorientierte, aber dennoch sympathische Familie auf ihrer Identitätssuche begleiten.
Einer Identitätssuche, die nicht gelingt.
Fazit: Ein kunstvolles, aber sehr unterhaltsames Buch über Identität und ein besonderer Beitrag zur Erinnerungskultur.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Yasmina Reza ist eine vielbeachtete Theaterautorin, daher sind auch bei ihren Romanen die Figuren das wichtigste. Hier sind es 3 erwachsene Geschwister einer französisch-jüdischen Familie.
Das ungekürzte Hörbuch geht 5 Stunden, 25 Minuten und wird von dem Film-und …
Mehr
Yasmina Reza ist eine vielbeachtete Theaterautorin, daher sind auch bei ihren Romanen die Figuren das wichtigste. Hier sind es 3 erwachsene Geschwister einer französisch-jüdischen Familie.
Das ungekürzte Hörbuch geht 5 Stunden, 25 Minuten und wird von dem Film-und Theaterschauspieler Peter Jordan gesprochen. Und seine Stimme passt gut zum lakonischen Icherzähler.
Der dialogbetonte Text hat eine Leichtigkeit, aber thematisch auch eine Schwere. Das mündet in eine Reise nach Auschwitz.Mit den Beschreibungen hatte ich so meine Probleme. Es wird eine andauernde Kakophonie von Streitgesprächen zwischen den Geschwistern.
Das Hörbuch hat mir etwas besser gefallen als Rezas früheres Buch Glücklich die Glücklichen.
Aber mehr als 3 von 5 Sterne kann ich nicht geben.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Hörbuch-Download MP3
Yasmina Reza möchte in ihrem Familienroman „Serge“ die Frage beantworten, was jüdisch sein bedeutet.
Die 3 Geschwister der Familie Popper begeben sich auf eine Reise nach Ausschwitz. Dabei wird in vielen Rückblenden und auf Nebenschauplätzen die Geschichte der …
Mehr
Yasmina Reza möchte in ihrem Familienroman „Serge“ die Frage beantworten, was jüdisch sein bedeutet.
Die 3 Geschwister der Familie Popper begeben sich auf eine Reise nach Ausschwitz. Dabei wird in vielen Rückblenden und auf Nebenschauplätzen die Geschichte der gesamten Familie beleuchtet. Unterschiedlicher könnten die 3 Protagonisten kaum sein: Während der Ich-Erzähler Jean lethargisch daherkommt, ist Nana sehr emotional, teilweise gar pathetisch und Serge der platte Macho.
Überzeugen konnte mich aufgrund fehlender Authentizität allerdings keiner davon. Ebenso wie die Geschichte, die mir zu unausgegoren ist und an den wichtigen Stellen doch nicht tiefer gräbt. Die großen Fragen beantwortet sie jedenfalls nicht und ich weiß nicht recht, was die Autorin dem Leser mitzuteilen versucht.
Ich habe den Roman als Hörbuch gehört und auch die Interpretation von Peter Jordan hat mich eher irritiert. Gerade die Darstellung von Nana fand ich zu spöttisch, hat sie doch durchaus Grund, Kritik an Serges Verhalten zu üben.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Was Peter Handke nicht schreiben sollte
Keine zehn Bücher ist es her, dass ich bei der jungen niederländischen Autorin Marieke Lucas Rijneveld sicher war, dass Handke Ärger bekommen, wenn er dasselbe Buch geschrieben hätte.
Gleiches gilt für Serge. Aber zum Glück …
Mehr
Was Peter Handke nicht schreiben sollte
Keine zehn Bücher ist es her, dass ich bei der jungen niederländischen Autorin Marieke Lucas Rijneveld sicher war, dass Handke Ärger bekommen, wenn er dasselbe Buch geschrieben hätte.
Gleiches gilt für Serge. Aber zum Glück stammt die französische Autorin aus einer jüdischen Familie und wer ihren Wikipedia-Eintrag liest, wird nicht umhinkommen in den chaotischen Poppers autobiografische Züge zu vermuten.
Auf meine Leseliste kam Serge, weil ich von einer satirischen Darstellung einer Reise nach Auschwitz hörte und mich auf Ähnliches wie in Robert Menasses „Hauptstadt“ freute. In der Tat ist das der Höhepunkt des Buches und nein als Skandal eignet es sich nicht. Mir hat es gefallen wie sie das Erlebnisinteresse der Touristen mit ständigem Handyklingeln und Fotowahnsinn schildert und wie sie das historische Desinteresse auch in der jüdischen Familie veranschaulicht. Aber wenn das Wort Vernichtungslager mit Nichts oder die Desinfektionsräume mit Sauna beschrieben werden kann von Verharmlosung nicht die Rede sein.
Leider sind nur etwa 30 Seiten der Reise gewidmet. Wenn die FAZ von „Meisterschaft der gestörten, lückenhaften Dialoge“ könnte ich dem zustimmen, wenn nicht ausgerechnet diese Meisterschaft das Leseerlebnis schmälern würde. Auf Seite 149 habe ich mich zum Beispiel gefragt, wo die lange wörtliche Rede eigentlich beginnt, die mit Herzchen aufhört. Da ich trotz minutenlanger Suche die Lösung nicht gefunden habe, freue ich mich über Kommentare.
Und wie bei Annie Ernaux fehlt jede Gliederung, allein Ernauxs Bücher sind deutlich kürzer.
Eigentlich schade, dass ich außer den Kindern den Überblick über die Personen verloren habe. Denn ihre Beschreibung des Schachspiels mit dem Schachspruch des Vaters: „Ein König der Spiele, ein Spiel der Könige“ ist meisterlich. „Da wurde Partien von Spassky, Fischer , Capablanca, Steinitz und anderen analysiert, aber sein Held, dessen Noblesse und Unerschrockenheit er unablässig pries, war Mikhail Tal, das Genie des Opferns, der Alexander der vierundsechzig Felder. Die ganzen russischen oder tschechischen Champions sind Juden, erklärte er uns. Und wenn der Typ kein Jude war, war er trotzdem Jude.“ (71f)
Als Schachtrainer werde ich diese Idee des Vaters übernehmen: „Sobald er sich bedroht fühlte, sagte er, oh, interessant, sehr interessante Situation! Analysieren wir die Varianten! Er verwandelte die Partie in eine Übung, sie wurde völlig neutral, und keiner gewann sie mehr.“ (72) Das passt zu der Schlussfolgerung: „Im Schach zu verlieren war bei uns eine niederschmetternde Demütigung.“ (72)
All diese schönen Zitat können nicht verhindern, dass Serge von mir wegen des fehlenden roten Faden, der außer in Auschwitz Familienkomödie mit Längen nur 3 Sterne erhält.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Schade eigentlich
Wen wundert’s, dass auch «Serge», Yasmina Rezas neuer Roman, eher wie ein Drama in Prosaform wirkt. Er lebt sprachlich von seinen funkelnden Dialogen, mit denen die französische Schriftstellerin in ihren Theaterstücken ja ebenfalls brilliert. Hier nun …
Mehr
Schade eigentlich
Wen wundert’s, dass auch «Serge», Yasmina Rezas neuer Roman, eher wie ein Drama in Prosaform wirkt. Er lebt sprachlich von seinen funkelnden Dialogen, mit denen die französische Schriftstellerin in ihren Theaterstücken ja ebenfalls brilliert. Hier nun kreuzen die Mitglieder einer jüdischen Familie verbal die Klingen. Der titelgebende Sohn Serge ist ein nichtsnutziger Aufschneider, der von seinem jüngeren Bruder Jean, dem Ich-Erzähler, maßlos bewundert wird. Jean selbst ist ein unscheinbarer Typ ohne Charisma, ein Leisetreter, der im Hintergrund bleibt und außer seiner Funktion als Protokollant auch kaum in das Geschehen hineinwirkt. Nana, die von allen geliebte Tochter der Poppers, hat einen nach Ansicht der Familie unpassenden Mann geheiratet. Sie ist aber im Beziehungs-Chaos der diversen anderen Familien-Mitglieder als einzige wirklich glücklich. Die nicht praktizierende jüdische Familie ist innerlich gespalten durch den Antisemitismus-Vorwurf, den der verstorbene Vater regelmäßig in die Debatte warf, wenn es um Israel und seine Politik ging. Wer diesen Staat kritisiert, ist gegen die Juden, so seine felsenfeste Überzeugung!
Das verkrachte Genie Serge, ein unsympathischer Kotzbrocken, ist als Sechzigjähriger auf der ganzen Linie gescheitert. Seine ominösen Geschäfte als Berater sind nur noch reine Luftnummern, die er sich aber unverdrossen schönredet, auch wenn er finanziell völlig am Ende ist. Seine Ehen sind ebenfalls gescheitert, um seine Kinder kümmert er sich kaum, sie leben bei den Müttern, Auch seine Beziehungen halten nicht lange, er vermasselt es jedes Mal. Als plötzlich auch die achtzigjährige Mutter stirbt, stellen die Geschwister fest, dass sie von ihren Vorfahren und deren Schicksal so gut wie nichts wissen, zum Fragen ist es nun aber zu spät. Auf Vorschlag der Tochter von Serge starten sie zu einem gemeinsamen Besuch nach Auschwitz. Wie zu erwarten ist auch hier Serge der Störenfried, er weigert sich, die wichtigen Stationen der Gedenkstätte zu betreten, zeigt keinerlei Interesse an dem, wovon doch auch seine eigene Familie betroffen war. Jean protokolliert, ebenfalls wenig beeindruckt, das abstoßende touristische Umfeld. Erstaunt stellt er fest, er habe noch nie eine so mit Blumen herausgeputzte Stadt wie Auschwitz gesehen. Was als Versuch gedacht war, das nach dem Tod der Mutter auseinander zu brechen drohende Familiengefüge zu erhalten, erweist sich als Illusion. «Nach unserer Rückkehr aus Auschwitz haben Nana und Serge übereinstimmend und ohne Absprache beschlossen, nie wieder miteinander zu reden».
Das zentrale Thema der Erinnerung wird hier weitgehend im Desaster einer tragikkomischen Reise behandelt, wobei die eigentlichen Motive der Suche nach familiären Spuren und nach Wahrheit völlig in den Hintergrund geraten. Mit ihrer genauen Beobachtungsgabe und der ungenierten Art, Figuren sezierend kühl zu beschreiben, gleichzeitig aber auch noch warmherzig auf sie zu blicken, bewirkt die Autorin eine zuweilen unfreiwillig komisch wirkende, sprachliche Ambivalenz. Und auch der aus diesem Blickwinkel beschriebene Auschwitz-Besuch erscheint als kühnes Unterfangen und wirft die drängende Frage nach einem angemessenen Umgang mit der unsäglichen historischen Vergangenheit auf.
Hervorzuheben sind die brillanten, oft sarkastischen und zuweilen sogar witzigen Dialoge in diesem Roman. Misslungen ist zweifellos die von Anfang an fragwürdige, nebulöse Erzählerfigur des Jean, der im Text eher selten auftritt und mangels klarem eigenen Profil kaum erkennbar ist. Wenn er als Ich-Erzähler dann aber zuweilen auch noch in die Position eines auktorialen Erzählers rückt, weil er Dinge und Vorgänge beschreibt, die er als Akteur gar nicht wissen kann, ist man als Leser vollends irritiert. Dieser illusionslose Roman, der ohne Moralisieren ein schwieriges Thema behandelt, liefert weder neue Erkenntnisse, noch ist er, abgesehen von den Dialogen, besonders unterhaltsam. Schade eigentlich!
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für