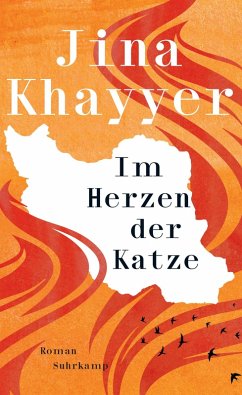Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Aufregend, wenn die Eltern auf der Flucht vor der Polizei ihre Kinder mitschleppen. Aber für die drei Geschwister verwandelt sich das Abenteuer bald in einen Albtraum. Ihre Odyssee führt sie quer durch Europa. Ein Roman wie ein Roadmovie. Eine ebenso tragische wie komische Familiengeschichte. Vater, Mutter und drei Kinder in der pfälzischen Provinz der Achtzigerjahre. Der Autoverkäufer Jürgen und seine Frau Jutta sind verschuldet, aber glücklich. Als auf einmal das »große Geld« da ist, wandert die Familie fluchtartig nach Südfrankreich aus. Dort leben vor allem die drei Geschwister w...
Aufregend, wenn die Eltern auf der Flucht vor der Polizei ihre Kinder mitschleppen. Aber für die drei Geschwister verwandelt sich das Abenteuer bald in einen Albtraum. Ihre Odyssee führt sie quer durch Europa. Ein Roman wie ein Roadmovie. Eine ebenso tragische wie komische Familiengeschichte. Vater, Mutter und drei Kinder in der pfälzischen Provinz der Achtzigerjahre. Der Autoverkäufer Jürgen und seine Frau Jutta sind verschuldet, aber glücklich. Als auf einmal das »große Geld« da ist, wandert die Familie fluchtartig nach Südfrankreich aus. Dort leben vor allem die drei Geschwister wie im Paradies, doch die Eltern benehmen sich immer seltsamer - bis ein Zufall enthüllt, dass der Vater ein Hochstapler ist. Er hat das Geld unterschlagen und bereits aufgebraucht, als sich die Schlinge enger zieht. Im letzten Moment flieht die Familie vor dem Zugriff der Behörden und die Jagd durch Europa geht weiter. Es ist ein freier Fall auf Kosten der Kinder, bis es unweigerlich zum Aufprall kommt ...
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 3.17MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Bekannt für fehlende wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale
Arno Frank, geboren 1971, ist Publizist und arbeitet als freier Journalist vor allem für den SPIEGEL, die taz und den Deutschlandfunk. Er lebt in Wiesbaden. Zuletzt erschienen von ihm die Romane So, und jetzt kommst du (2017) und Seemann vom Siebener (2023).
Produktdetails
- Verlag: Tropen
- Seitenzahl: 352
- Erscheinungstermin: 1. März 2017
- Deutsch
- ISBN-13: 9783608100792
- Artikelnr.: 47114734
»Fasziniert verfolgt man diese atemlose Flucht von einem Land ins andere, die auch immer eine Flucht vor der Realität ist. Franks fast nüchterne Beschreibung aus der Sicht eines Jungen, der er mal war, erschüttert und begeistert zugleich.« Brigitte, 12.2017 »Arno Frank erzählt diese autobiografische Geschichte in einem hinreißenden Ton ... Ähnlich wie bei "Tschick", der anderen großen deutschen Road Novel unserer Tage, ahnt man beim Lesen, dass das bald verfilmt werden muss. Der situative Humor ist ähnlich genau wie bei Herrndorf, der rasante Plot lässt einen sowieso nicht los, man ist gerührt und bestürzt zugleich und will immer neue Passagen anstreichen.« Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, 05.04.2017 »Sein Roman "So, und jetzt kommst du"
Mehr anzeigen
ist das aktuelle Lieblingsbuch unserer Redaktion. Es ist eine Familiengeschichte, die so schräg, so komisch und so tragisch ist, dass sie eigentlich kaum wahr sein kann. Ist sie aber.« Katty Salié, ZDF aspekte, 10.03.2017 »der Text, den Arno Frank geschrieben hat, zerreißt einem das Herz, weckt Mitleid und Furcht und alle möglichen widersprüchlichen Gefühle, man rast wie die Familie Frank Richtung Süden und wieder zurück ... durch die dreihundertfünzig Seiten und hofft, dass die Familie nie gefasst wird. Oder dass sie doch gefasst wird ... Ein Roman über Rücksichtslosigkeit, Weltverweigerung, Grausamkeit und Lebenstrotz. Man ist dankbar, dass man ihn nur lesen, nicht leben musste.« Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 19.03.2017 »Ein Juwel in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur!« Jürgen Deppe, NDR Kultur, 06.07.2017 »Das Buch liest sich wie ein Schlitten den Hang runterrast ... Der Leser durchlebt eine unberechenbare Reise - eine Mischung aus Roadtrip und hakenschlagender Flucht.« Alexander Wasner, SWR 2 Forum Buch, 12.03.2017 »Frank erzählt leichtfüßig und liebevoll von seinen Figuren.« Tina Rausch, Münchner Feuilleton, Juli 2017 »Fasziniert verfolgt man diese atemlose Flucht von einem Land ins andere, die auch immer eine Flucht vor der Realität ist. Franks nüchterne Beschreibung aus der Sicht des Jungen, der er mal war, erschüttert und begeistert zugleich.« Meike Schnitzler, Brigitte, Juli 2017 »Schräg, komisch und tragisch.« Myself, Juni 2017 »Beim Lesen darf gelacht werden, es kann aber auch geweint werden. Auf jeden Fall aber sollte dieses Roadmovie, diese Familientragödie, diese wahre Geschichte gelesen werden.« Dominik Bloedner, Badische Zeitung, 15.04.2017 »"So und jetzt kommst du" ist ein Roman wie ein Roadmovie, mit einem Erzähl-Helden wider Willen, der auch ein Rückblick auf die 80er Jahre ist.« Helmut Pusch, Südwest Presse, 25.03.2017 »Großartig!« Wolfgang Weber, Badische Neueste Nachrichten, 04.06.2017 »Familiengeschichten sind langweilig? Diese hier nicht.« Hannoversche Allgemeine Zeitung, 01.03.2017 »Stets ist man dran an einer Geschichte, die man, auch so ähnlich, noch nicht gelesen hat. Man fühlt, wie sich die Schlinge mehr und mehr um die Protagonisten zuzieht, zittert mit ihnen und will wissen, wie es nicht nur weiter, sondern wie dieses Hasardspiel mit hohem Einsatz, dem des Lebens der Eltern und dem ihrer Kinder, ausgeht. Es ist ein Zeichen für die Güte eines Romans, wenn auf der letzten Seite bedauernd festgestellt werden muss, dass er schon zu Ende ist.« Peter Zimmermann, Ö1 Ex libris, 26.03.2017 »Als Leser sollte man sich, so viel vorab zu den Risiken und Nebenwirkungen, das Buch nur am Wochenende vornehmen. Werktägliche Lektüre kann nämlich zu sehr kurzen Nächten und verminderter Arbeitsleistung führen: Man kommt einfach nicht los von dieser Geschichte, die einen in ein Wechselbad der Gefühle stürzt.« Volker Milch, Wiesbadener Kurier, 19.05.2017 »Mit seinem Debüt gelingt Arno Frank das seltene Kunststück, gleichermaßen zu unterhalten wie zu erschüttern. Anfangs noch hochkomisch und skurril, ist das Buch später vor Spannung kaum auszuhalten.« Frank Rudkoffsky, Lift, August 2017 »"So, und jetzt kommst du" ist ein Buch, das in seiner Schönheit den Schrecken des Niedergangs einer Kindheit nur schwach verhüllt - und das ist genau die richtige Art, solch einen Niedergang zu erzählen.« Simona Turini, indie-republik.com, 24.04.2017
Schließen
Sein Roman »So, und jetzt kommst du« ist das aktuelle Lieblingsbuch unserer Redaktion. Es ist eine Familiengeschichte, die so schräg, so komisch und so tragisch ist, dass sie eigentlich kaum wahr sein kann. Ist sie aber. ZDF "Aspekte"
Ich war in dieser Geschichte so gefangen, dass ich sie in einem Rutsch durchgelesen habe.
Ein Roadmovie, mit oftmals unfreiwilligen Insassen. Ich bin jetzt ehrlich total bestürzt!
Jürgen Frank scherte sich nichts um ehrliche Arbeit. Davon wird man schließlich nicht reich. Er …
Mehr
Ich war in dieser Geschichte so gefangen, dass ich sie in einem Rutsch durchgelesen habe.
Ein Roadmovie, mit oftmals unfreiwilligen Insassen. Ich bin jetzt ehrlich total bestürzt!
Jürgen Frank scherte sich nichts um ehrliche Arbeit. Davon wird man schließlich nicht reich. Er verhökerte gebrauchte Autos. Sammelte bis unter das Dach Mist, von dem er dachte, die große Kohle zu machen. Bei Menschen, die ihm halfen, hatte er eine ganz besondere Art sich zu bedanken. Er haute sie übers Ohr. Veruntreute Gelder, die für Investitionen des Gebrauchtwagenhandels gedacht waren. So kam es, dass dem Saarländer das Haus gepfändet wurde. In der Nähe von Kaiserslautern fand er in einem Waldhaus eine neue Bleibe. Natürlich hatte Jürgen Frank nichts Besseres zu tun, als weiter über seine Verhältnisse zu leben.
Ihr findet das schlimm? Das ist noch nicht alles. Jürgen ist/war (weiß ich nicht so genau) eigentlich nicht alleine auf der Welt. Da gibt es den großen Jungen, der Erzähler dieser Familientragödie ist. Arno Frank. Arno fand ich klasse. Als Jungen zumindest. Ich denke, er ist heute noch ein Charaktermensch. Er ist der Held in dieser Geschichte. Ein Überlebenskünstler, der aus jeder Situation das Beste macht.
Dann die kleinere Schwester Jenny, die für ihr Alter damals schon sehr viel Grips hatte. Das zeigte sich vor allem, ziemlich am Ende des Buches.
Das Baby Fabian konnte die Tragweite dieser Tragödie noch nicht erkennen, und kam eigentlich stets glücklich rüber.
Die Mutter kam mir selber vor wie ein Kind. Sie machte alles mit, was ihr Gatte entschieden hatte. Trotzdem muss man ihr zugute halten, dass sie ihre Kinder aufrichtig geliebt hatte. Leider war sie ihrem Mann hörig. Interpol war mittlerweile eingeschaltet.
Nachdem sie von der Polizei gesucht wurden, begann ein Roadmovie durch Europa.
In Nizza hatte die Familie in Luxus geschwelgt. Als der Papa wieder pleite war, ging es weiter nach Lissabon. Dort verließ den Familienvater der Einfallsreichtum. Zum ersten mal wurde große Armut spürbar. Von Lissabon ging es wieder zurück in die Heimat. Doch, auch dieser Aufenthalt sollte nicht lange wehren.
Mir haben die Kinder total leid getan. Immer wieder mussten sie bei Nacht und Nebel mit ihren Eltern fliehen. Ich weiß, das ist alles längst vorbei. Trotzdem! Ich denke, die seelischen Narben werden nie ganz verheilen.
Stellenweise habe ich mich an meine Kindheit erinnert. Die Mutter hörte Platten von Wencke Myhre. Wencke war in meiner Kindheit meine Lieblingssängerin. Dann hörte man sich James Last an. Mit James bin ich groß geworden.
Ich denke, auch für die Kinder war das Familienleben lange Zeit normal.
Nach Nizza befanden sich auch zwei Hunde im Gepäck. Eine Szene mit den Vierbeinern hatte mich würgen lassen. Mir war hundeübel. Seid also schon mal vorgewarnt.
Mein Fazit
Jeder Mensch kann Fehler machen. Jeder Mensch sollte auch die Gelegenheit bekommen, wieder ein normales Leben zu führen. Bei Jürgen Frank war jedoch Hopfen und Malz verloren.
Dass mich diese Geschichte so emotional aufwühlen konnte, ist der Tatsache geschuldet, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt. Über 9 Jahre lässt uns Arno Frank an seiner Kindheit teilhaben.
In den 80 igern konnte eigentlich jeder Deutsche gut leben, der den Weg zur Arbeit gefunden hat.
Es waren unsere goldenen Jahre! Ausgenommen natürlich Menschen, die gesundheitlich nicht dazu in der Lage waren.
Packend erzählt und ohne dabei ins Jammertal abzurutschen, erzählt Arno aus seinem Leben.
Für mich bewundernswert, dass er trotz schwieriger Kindheit, einen guten Weg eingeschlagen hat. RESPEKT!
Und für alle ein kleiner Denkanstoß, die ihr Scheitern im Leben ausschließlich in der Kindheit suchen. Das ist bestimmt bei einigem Menschen berechtigt. Bei sehr Vielen aber nicht. Klingt auch bei erwachsenen Menschen lächerlich, wenn nach Jahrzehnten immer noch Mama und Papa für sämtliches Versagen verantwortlich sein sollen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Ich-Erzähler in „So, und jetzt kommst du“ erzählt uns von seiner Kindheit. Diese wurde vor allem durch den Vater geprägt, der immer irgendein Geschäft am Laufen hatte und davon überzeugt war, dass sie bald reich sein würden. Doch selbst ein Kind merkt, …
Mehr
Der Ich-Erzähler in „So, und jetzt kommst du“ erzählt uns von seiner Kindheit. Diese wurde vor allem durch den Vater geprägt, der immer irgendein Geschäft am Laufen hatte und davon überzeugt war, dass sie bald reich sein würden. Doch selbst ein Kind merkt, dass etwas nicht stimmt: sie müssen aus ihrem Haus ausziehen, der Vater bekommt Briefe mit offiziellen Wappen, die er jedoch nicht öffnet. Und immer wieder das Versprechen, dass sie bald reich sein würden. Eines Tages ist es dann scheinbar so weit, von einem Tag auf den anderen fahren sie nach Südfrankreich, Vater, Mutter, der Erzähler und seine beiden kleinen Geschwister. Doch diese Auswanderung erinnert eher an eine Flucht und das ist sie auch.
Nachdem ich die ersten Seiten von „So, und jetzt kommst du“ gelesen hatte, habe ich eine skurrile Familiengeschichte mit schrulligen Charakteren erwartet. Aber schon bald hat mich die Wahrheit eingeholt. Denn der Vater ist ein Hochstapler und auf der Flucht vor der Polizei und die Kinder müssen es ausbaden. Die Eltern haben kaum Verantwortungsbewusstsein für ihre Kinder, der Vater ist phasenweise sogar aggressiv und gewalttätig, die Kinder haben manchmal nicht mal genug zu essen und sind meistens auf sich alleine gestellt. Der Vater versucht sogar, den Sohn auf seine Seite zu ziehen, indem er ihm erklärt, wie man sich im Leben durchtricksen kann, denn: „Jeden Tag steht irgendwo ein Dummer auf.“
Dabei bleibt der Ton des Erzählers immer leicht und man merkt, wie sich Kinder ihrer Umgebung und den Umständen anpassen können, wie sie immer versuchen, das Beste aus einer Situation zu machen. Das ist dem Autor sehr gut gelungen.
Das bedrückendste an dem Buch ist, dass der Arno Frank anscheinend seine eigene Kindheit schildert. Solche Erfahrungen wünscht man wirklich niemandem! Während er Lektüre hat mein Mutterherz die ganze Zeit geweint und ich hätte am liebsten nicht weitergelesen. Die Kinder werden seelisch und körperlich misshandelt und vernachlässigt, ebenso die Hunde, die später angeschafft werden.
Trotz der Kritikpunkte (die sehr subjektiv sind) gebe ich vier Sterne, denn: Erzählen kann der Autor. Man sollte sich vor dem Lesen aber gut überlegen, ob man sich auf solch eine bedrückende Geschichte einlassen kann und will.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Aufwühlend und erschreckend
Was für Geschichten schreibt das Leben manchmal? Ich habe oft fassungslos verfolgt, was dieser Familienvater dem Rest der Familie aufgebürdet hat - angeblich mit besten Absichten.
Jürgen ist, vereinfacht beschrieben, ein Gernegroß. Er will …
Mehr
Aufwühlend und erschreckend
Was für Geschichten schreibt das Leben manchmal? Ich habe oft fassungslos verfolgt, was dieser Familienvater dem Rest der Familie aufgebürdet hat - angeblich mit besten Absichten.
Jürgen ist, vereinfacht beschrieben, ein Gernegroß. Er will es mal zu Geld bringen. Zu viel Geld. Zu extrem viel Geld und Luxus - ohne dafür zu arbeiten, versteht sich.
Mit Sätzen wie "Es steht jeden Tag ein Dummer auf" und Anleitungen, wie man Schrott schönreden kann macht er seinem Sohn deutlich, was er unter "arbeiten" versteht. So wundert es den Leser nicht, dass der Vater bald auf Abwege gerät, um an das große Geld zu kommen.
Als die Polizei ihm zuleibe rücken will, packen er und Mutter Jutta das nötigste ein und alles mit den 3 Kindern in den Wagen und los geht es Richtung Frankreich. Es wird ein luxuriöses Haus gemietet, ein chicer Sportwagen und 2 Hunde gekauft, die beiden größeren Kinder in der Privatschule angemeldet und ansonsten in den Tag gelebt. Nachts macht Vater später Besuche im Spielcasino um mit einem "sicheren System" Geld heran zu schaffen.
Das geht natürlich nur so lange gut, wie das mitgenommene Geld reicht. Danach folgt eine Flucht auf die nächste und die Zustände werden immer katastrophaler.
Nur wenige Bücher haben mich bisher so ergriffen. Weil es sich um eine wahre Begebenheit handelt, die vom Autor, dem Ich-Erzähler, lediglich abgewandelt wurde. Wie kann ein Vater seine Kinder in solche Situationen bringen? Wie kann er in doch so kurzer Zeit die Psyche sämtlicher Familienmitglieder so nachhaltig demolieren?
Der Mann ist zerfressen vom Geltungswahn und Schein ist für ihn wichtiger als Sein. Am schlimmsten empfand ich dieses Lügengespinst, das er um sich herum aufbaute, selbst seiner Familie gegenüber. Und es wurde erwartet, dass auch seine Kinder und Frau seine Lügen verbreiten und stützen.
Mit den Monaten ahnen die Kinder, das alles nicht mit rechten Dingen zugeht und sie eigentlich auf der Flucht sind und gar nicht umgezogen. Sehr tragisch für mich auch die Stelle, als die jüngere Tochter Jeany erkennt, dass die Polizei doch eigentlich nur ihren Vater sucht und sonst niemanden aus der Familie und das alles besser werden würde, wenn er verhaftet und eingesperrt würde.
Zudem hat der Vater noch eine latent gewalttätige Ader, die zum Ausbruch kommt sobald ihm etwas gegen den Strich läuft. Da wird der Sohn wutentbrannt geschlagen, dass er zu Boden geht, weil das Hotel endlich seine Rechnung bezahlt haben möchte oder der kleine Bruder mit nicht mal 2 Jahren hemmungslos geohrfeigt, weil die Hunde sich krank vor Hunger eine seiner Windeln vom Müll geholt haben um sie zu fressen und alles im Zimmer verteilen.
Um es gleich zu sagen: Die komischen und humorvollen Stellen dieses Buches konnte ich leider nur wenig entdecken. Es war immer dieses Lachen, das einem im Halse stecken bleibt.
Arno Frank hat jedoch ein Buch geschaffen, das einem wirklich ans Herz greift. Meist sehr sachlich geschildert und trotz allem so nah am Geschehen. Und immer wieder tauchen da plötzlich Sätze auf, so poetisch und schön, dass ich sie glatt nochmal lesen musste, weil sie so perfekt klangen. Bsp.:
"Vielleicht bewegen wir uns auf dieser Fahrt nicht im Raum und stehen in Wahrheit still, während die Orte in rätselhafter Konstellation sich von uns weg, zu uns hin, an uns vorbei bewegen."
Mir hat sein Schreibstil und vor allem seine immer wieder aufblitzende Schreibgewalt immens gut gefallen. Es war trotz der fürchterlichen Begebenheiten ein wahres Vergnügen, ihn bei seiner Geschichte zu begleiten.
Hinzu kommt, dass mir vieles so vertraut ist, von dem er schreibt - wie eine kleine Zeitreise.
Fazit: Ein außergewöhnliches Buch in hervorragendem Schreibstil mit einer absolut unglaublichen Story! Vielen Dank an Arno Frank, dass er uns teilhaben ließ an seiner Odyssee aus der Kindheit!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Vater, Mutter, drei Kinder – eine ganz normale Familie, wie es zunächst den Anschein hat. Doch es fällt auf, dass sie in letzter Zeit mehrmals umgezogen sind. Jetzt, 1984, wohnen sie in einem Haus mitten im Wald in der Nähe von Kaiserslautern. Vater Jürgen, der schon immer …
Mehr
Vater, Mutter, drei Kinder – eine ganz normale Familie, wie es zunächst den Anschein hat. Doch es fällt auf, dass sie in letzter Zeit mehrmals umgezogen sind. Jetzt, 1984, wohnen sie in einem Haus mitten im Wald in der Nähe von Kaiserslautern. Vater Jürgen, der schon immer von Reichtum und vom mondänen Leben träumte, verkauft derzeit gebrauchte Nobelkarossen. Mutter Jutta gibt gelegentlich Tupper-Partys und ist ansonsten ganz zufrieden mit ihrem Leben, so wie es ist. Der 13jährige Arno besucht das Gymnasium in Kaiserslautern, seine fünf Jahre jüngere Schwester Jeany die Grundschule im benachbarten Ort und der Jüngste, Fabian, ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Doch statt des erhofften Reichtums kommen nun öfters Briefe vom Gericht und gelegentlich steht auch die Polizei vor der Tür. Dann, eines Tages war er plötzlich da, der große Geldsegen, der Reichtum. Um Mitternacht werden die Kinder geweckt, rasch das Nötigste eingepackt, und ab geht’s im geliehenen Benz Richtung Süden, an die Côte d’Azur. Jetzt kann man es sich gut gehen lassen, man hat ja schließlich „einen Arsch voll Geld“, wie Vater sich ausdrückt. Man mietet eine Villa mit Meerblick und Swimmingpool und gibt das Geld mit vollen Händen aus. Abends geht Vater ins Casino nach Nizza oder Cannes, zum ‚Arbeiten‘, wie er es nennt. Dann steht eines Tages wieder die Polizei vor der Tür – und wieder flüchtet man mitten in der Nacht, diesmal ohne Geld, denn das ist aufgebraucht …
Arno Frank, Jahrgang 1971, studierte Kunstgeschichte und Philosophie, absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München, war elf Jahre Redakteur bei der „taz“ in Berlin, arbeitete als freier Kulturjournalist für verschiedene Magazine, lebt jetzt in Wiesbaden und ist dort Inlandskorrespondent der „taz“. Seine Kindheits- und Jugenderlebnisse hat er, leicht verfremdet. In seinem ersten Roman „So, und jetzt kommst du“ zusammen gefasst und nach dem Tod seiner Mutter veröffentlicht.
Protagonist und Erzähler seiner Erlebnisse ist Arno als dreizehn- bis fünfzehnjähriger Junge. Der Schreibstil ist sehr angenehm, ausdrucksstark und bildhaft. Zu Beginn jedoch, wenn Arno als kleines Kind über seine Erfahrungen berichtet, ist meiner Meinung nach die Sprache zu ‚erwachsen‘, bzw. nicht der kindlichen Sprach- und Denkweise angepasst. Die Geschichte liest sich ansonsten gut und flüssig und hat bei aller Tragik, zumindest in der ersten Hälfte, auch ihre komischen Momente. Doch irgendwann wird dem Leser klar, dass der Spaß und das Abenteuer zu Ende ist. Plötzlich hat man nur noch Mitleid mit den Kindern und den beiden Hunden, die auf dieser Odyssee auch mitgeschleppt werden, ärgert sich über die Mutter, die alles so teilnahmslos hinnimmt, und bekommt Hass auf den Vater, der in seiner Hilflosigkeit gewalttätig wird und mit seiner Großspurigkeit die ganze Familie ins Unglück stürzt.
Anfangs zieht sich die Handlung etwas verhalten dahin, doch mit der Flucht kommt deutlich mehr Spannung auf. Man fragt sich, wie lange das noch gut gehen kann und warum immer wieder der Zusammenhalt der Familie beschworen wird. Selbst als kein Geld für Essen und Unterkunft mehr da ist, werden Vaters Entscheidungen nicht infrage gestellt. Ist das noch Liebe, Arglosigkeit oder eher Dummheit? Man hofft, dass die Familie endlich merkt, dass er kein Held, sondern ein ganz gewöhnlicher Betrüger ist. Es macht mich betroffen, dass die Kinder dadurch keine normale Kindheit erleben konnten.
Fazit: Ein gut gelungenes Romandebüt, eine ausdrucksstark erzählte Geschichte die berührt und betroffen macht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
"So, und jetzt kommst du" ist eines der großartigsten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Vom ersten Satz an wird man tief in die Momentaufnahmen hineingezogen. Der Autor mäandert von einer Szene zur nächsten, es offenbart sich immer deutlicher, wie …
Mehr
"So, und jetzt kommst du" ist eines der großartigsten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Vom ersten Satz an wird man tief in die Momentaufnahmen hineingezogen. Der Autor mäandert von einer Szene zur nächsten, es offenbart sich immer deutlicher, wie ungewöhnlich diese Familie ist. Das von Anfang an präsente bedrückende und bedrohliche Gefühl nimmt immer stärker zu, man sieht die Katastrophe und die Auswegslosigkeit kommen. Doch genauso hilflos fasziniert wie die Kinder steht man passiv daneben und wartet, schicksalsergeben.
Franks Sprache ist so dicht, so unmittelbar und so bildgewaltig, dass die Sätze unter die Haut kriechen, sich dort einnisten und man sie nicht mehr abstreifen kann.
Großartig.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein Buch mit Tempo und voller Energie
Arno Franks "So, und jetzt kommst du" ist ein großartiger Roman, weil er wahrhaftig die Emotionen des Protagonisten widergibt. Es geht um die schwierige Kindheit eines Jungen und seiner Geschwister bei einem kriminellen Vater und einer labilen …
Mehr
Ein Buch mit Tempo und voller Energie
Arno Franks "So, und jetzt kommst du" ist ein großartiger Roman, weil er wahrhaftig die Emotionen des Protagonisten widergibt. Es geht um die schwierige Kindheit eines Jungen und seiner Geschwister bei einem kriminellen Vater und einer labilen Mutter.
Das Buch ist leicht und schnell zu lesen, dabei geschickt in vier Teilen plus Epilog konzipiert. Der erste Teil zeigt eine Kindheit in den siebziger jahren. Wer aus dieser Zeit stammt, wird viel wiedererkennen. Die Erzählweise ist sehr gelungen, da der Junge eine beobachtende Position einnimmt, dabei auch nicht immer alles versteht. Das gibt dem Text viel Glaubwürigkeit. Arno Frank taucht in die Erinnerungen tief ein, Aufgrund der Thematik wurde ich an Jeanette Walls "Schloß aus Glas" erinnert. Doch bei Arno Frank dominiert zuerst die deutsche Provinz, bis die Familie überraschend nach Frankreich geht. Später müssen sie sogar durch verschiedene Länder fliehen, weil der Vater polizeilich gesucht wird. Eine schwere Lage für die Kinder. Tragisch, dasss die Kinder so leiden müssen, denn sie sind der Situation hilflos ausgesetzt. Der Vater ist oft unberechenbar, deswegen nimmt sich der Junge auch oft in Acht vor ihm. Mit der Mutter ist es einfacher und von Liebe geprägt, aber sie wirkt schon sehr labil.Es gibt wenige Momente für den Jungen, in denen er Normalität erlebt, schnell wird er wieder daraus herausgerissen. Die Flucht geht an die Sibstanz, bis hin zur seelischen Erschöpfung.
Ich schätze es sehr, wie Arno Frank den Zeitverlauf durch Anspielungen auf Ereignsse setzt, z.B. von Grace Kellys Tod bis hin zu Tschernobyl. So kann man sich als Leser gut orientieren, ohne das auf platte Weise Jahresdaten genannt werden.
Das Buch besitzt eine innere Spannung, man ist nah dran an dem Icherzähler und kann emotional mitfühlen. Das liegt auch daran, dass eine wahre Geschichte erzählt wird.
Wirklich wieder eine originelle und gute Veröffentlichung des Tropen-Verlags.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Geschichte einer gestohlenen Kindheit
So, und jetzt kommst du, sagt der Vater zum Sohn, nachdem er ihm wieder einmal seine Sicht der Welt und seine hochfliegenden Pläne erzählt hat. Es hört sich nicht an, als ob er wirklich die Sicht des Sohnes hören möchte, es ist vielmehr …
Mehr
Geschichte einer gestohlenen Kindheit
So, und jetzt kommst du, sagt der Vater zum Sohn, nachdem er ihm wieder einmal seine Sicht der Welt und seine hochfliegenden Pläne erzählt hat. Es hört sich nicht an, als ob er wirklich die Sicht des Sohnes hören möchte, es ist vielmehr der Schlusspunkt der Konversation, denn in seine Lebensweise lässt er sich sowieso nicht reinreden, er weiß sowieso alles besser. Ehrlich arbeitende, sich abschuftende Menschen hält er für Idioten, und so ist es wenig verwunderlich, dass er selbst versucht, sein Geld mit windigen Geschäftsmodellen zu machen. "Jeden Tag steht ein Dummer auf", ist ein weiterer seiner Sprüche.
Doch es entwickelt sich nicht wie gewünscht, und die Familie verliert ihr Haus. Der Familienvater arbeitet bei einem Gebrauchtwarenhändler, zumindest solange, bis das große Geld kommt, das dann eines Tages anscheinend tatsächlich eingetroffen ist. Wie, weiß keiner so genau, am allerwenigsten der Sohn, der Ich-Erzähler der Geschichte.
Was folgt, ist eine Odyssee durch Europa. Bei Nacht und Nebel verlassen sie auf der Flucht vor der Polizei ihre Wohnung im Pfälzerwald und landen zunächst in Südfrankreich. Dort leben sie in Saus und Braus, bis das Geld alle ist und sie wieder fliehen müssen. Die nächste Etappe führt sie nach Lissabon, wo sie in einer kleinen Pension hausen. Hier beginnt die Geschichte, sehr bedrückend zu werden. Da das Geld fehlt, ernährt sich die ganze Familie von Sardinen und Brathühnchen. Die Eltern verbringen die Tage vor dem Fernseher, Frank und seine Schwester streifen in der Stadt herum. Das einzig schöne Erlebnis während dieser deprimierenden Zeit ist ein Tagesausflug, den der Junge mit einer deutschen Familie unternimmt, die ihn für einen Tag wie einen Sohn behandelt. Als die Familie auch Lissabon überstürzt verlassen muss, beginnt der totale Absturz...
Die Geschichte ist sehr gut und flüssig geschrieben. Der Autor versteht etwas davon, mit wenigen Worten viel auszudrücken: "Weihnachten und Neujahr kommen und gehen so unmerklich wie eine Bodenwelle beim Autofahren." Allerdings liegen manche seiner Bilder etwas daneben, zum Beispiel die "adipösen Wolken" oder "frühvergreiste Hochhäuser".
Zunächst liest sich die Geschichte noch wie ein launiger Roadtrip mit einem schlitzohrigen, aber nicht unsympathischen Vater, der alles lenkt. Doch im weiteren Verlauf erkennt man die kriminelle Energie eben dieses Vaters und wie sich dieses ständige Leben auf der Flucht negativ auf die Familie auswirkt. Um den Vater und seine Lügengeschichten zu decken, müssen auch die Kinder ständig lügen. So kommt es einem wie eine Befreiung vor, als diese wahnwitzige Reise zu Ende geht und die Kinder mehr schlecht als recht versuchen müssen, wieder in ein normales Leben zurückzufinden.
Ein sehr berührendes Buch, das sich stellenweise liest wie ein Krimi.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Auf der Flucht
Was als Abenteuer beginnt, wird zum Albtraum – mit den Eltern auf der Flucht vor der Polizei. Die Familie wandert zunächst nach Südfrankreich aus und leben dort, vor allem die Kinder, zunächst wie im Paradies. Doch die Idylle zerbricht, als herauskommt, dass …
Mehr
Auf der Flucht
Was als Abenteuer beginnt, wird zum Albtraum – mit den Eltern auf der Flucht vor der Polizei. Die Familie wandert zunächst nach Südfrankreich aus und leben dort, vor allem die Kinder, zunächst wie im Paradies. Doch die Idylle zerbricht, als herauskommt, dass der Vater ein Hochstapler ist und Geld unterschlagen hat. Die Familie flieht im letzten Moment und eine Jagd durch Europa beginnt.
Das Cover ist recht unscheinbar, passt aber hervorragend zum Buch und nach dem Lesen des Klappentextes war ich gespannt, was mich hier erwartet. Die handelnden Personen sind gut beschrieben und ich konnte mir alle gut vorstellen, ebenso die Handlungsorte des Buches. Der Schreibstil von Arno Frank ist flüssig und locker und es hat Spaß gemacht, der Geschichte zu folgen. Die Erzählweise besticht durch viel Humor, aber auch traurigen Stellen und immer aus der Sicht des Kindes erzählt. Das macht es umso berührender.
Ein unterhaltsamer und bewegender Roadmovie, den man einfach mal lesen muss.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Aus der pfälzischen Provinz begibt sich eine Familie nicht ganz freiwillig auf eine Reise. Mit den drei Kindern im Gepäck geht es zunächst nach Südfrankreich, wo sie aufleben und das Dasein in einer Villa oberhalb der Côte d’Azur genießen. Doch das …
Mehr
Aus der pfälzischen Provinz begibt sich eine Familie nicht ganz freiwillig auf eine Reise. Mit den drei Kindern im Gepäck geht es zunächst nach Südfrankreich, wo sie aufleben und das Dasein in einer Villa oberhalb der Côte d’Azur genießen. Doch das süße Leben währt nicht lange und bald schon steht die Weiterreise an, Portugal ist dieses Mal das Ziel. An den Rand Europas führt sie die Flucht und allmählich schwant den Kindern, dass diese Reise nicht ganz freiwillig ist und dass ihr liebender Vater kein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern ein gesuchter Ganove ist, der sich samt Familie vor der Polizei versteckt. Doch da droht schon wieder der nächste Aufbruch, nach Paris wird angesteuert, wo alles besser werden soll – oder doch alles plötzlich ein Ende findet?
Beim Lesen des Buchs schwankt man zwischen Entsetzen und Vergnügen. Ganz wunderbar gefällt mir der junge Erzähler, der in glaubwürdig naiver Weise seine Eltern beobachtet und vieles sieht, aber nicht verstehen oder einordnen kann. So manches schwant dem Leser recht schnell, aber es wird durch die noch kindliche Sicht auf die Dinge in eine Leichtigkeit versetzt, die einem immer wieder schmunzeln lässt. Der Vergleich mit den Klassenkameraden beispielsweise, die Markenkleidung tragen und deren Eltern hohe Posten begleiten, während er als „Sohn eines Wimpelhändlers von der Ausfallstraße“ nicht mithalten kann. Auch kann er nicht verstehen, was dieses ominöse „Dédé Air“ eigentlich ist, er vermutet ein französisches Protektorat, auch wenn dort irgendwelche Deutschen offenbar wohnen. Ein Highlight auch der Besuch des Betzenbergs mit dem Opa, der zugleich eine wichtige Lektion fürs Leben parat hat:
„Wenn um dich herum die Massen eine bestimmte Meinung haben, dann musst du auf deiner eigenen Meinung beharren. Dann ganz besonders, verstehst du? Die Masse wird dann aber meistens sauer. Und dann ist es besser, man verzieht sich.“ (Pos. 801)
Die kriminelle Energie der Eltern wird lange Zeit nicht offen thematisiert, für die Kinder ist die Reise in die Fremde spannend und ein Spaß zugleich. Dass das Verhalten verantwortungslos und indiskutabel ist, steht außer Frage; jedoch spürt man auch die Verzweiflung, der vergebliche Versuch irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und die Sorgen von den Kindern fernzuhalten, ihnen trotz der Widrigkeiten ein gutes und sorgenfreies Leben zu bieten. In diesem Punkt kann man den Eltern kaum einen Vorwurf machen, bis zum Ende sind sie um das Wohl der drei bemüht und besorgt, aber es geht ihnen die Luft aus. Man ist kritisch ihnen gegenüber und kann doch nicht umhin, auch Sympathien zu entwickeln, gerade ob der Bauernschläue, die Vater Jürgen an den Tag legt. In Portugal erläutert er seinem Sohn sein Konzept von Wahrheit, als sie bei dem Concierge Mitleid wecken wollen. Entsetzt fragt der junge Arno, ob der Vater die Wahrheit erzählt habe: „Aber natürlich. Manchmal muss man einfach ehrlich sein. (…) – das ist doch gar nicht die Wahrheit. – Für ihn jetzt schon.“ (Pos. 3087).
Viele spannende Themen werden bei diesem ungewöhnlichen Roadtrip verarbeitet. Das Erwachsenwerden und der Blick auf die Eltern und die Realisierung, dass diese vielleicht nicht die Personen sind, für die man sie hält. Das fragile Gebilde einer Ehe, die durch die Umstände strapaziert wird. Das Zurechtfinden an anderen Orten, in anderen Ländern. Und die Frage, wieviel eine Familie aushalten kann und muss und ob es eine Grenze des Zumutbaren gibt.
Ein Roman, der gekonnt zwischen Unterhaltung und Ernsthaftigkeit balanciert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Meine Meinung:
Der Schreibstil des Buches hat mir sehr gut gefallen, das Buch ist sehr flüssig und auch interessant geschrieben. Beeindruckt hat mich auch die Tatsache, dass die Geschichte auf einer wahren Geschichte beruht. Man kann ubd will sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein …
Mehr
Meine Meinung:
Der Schreibstil des Buches hat mir sehr gut gefallen, das Buch ist sehr flüssig und auch interessant geschrieben. Beeindruckt hat mich auch die Tatsache, dass die Geschichte auf einer wahren Geschichte beruht. Man kann ubd will sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein Familienvater immer wieder Straftaten begeht und damit im Grunde die ganze Familie zwingt, immer wieder auf der Flucht zu sein. Das kann man sich als Normalbürger nicht wirklich für die eigene Familie vorstellen. Aber jeder geht halt anders mit seinem Leben um.
Fazit:
Ungewöhnliche Geschichte einer ungewöhnlichen Familie.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für