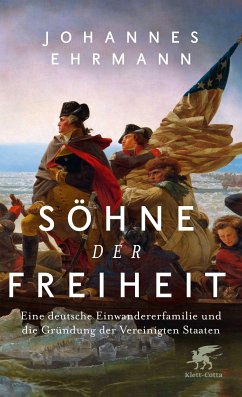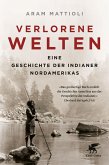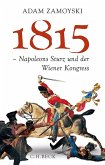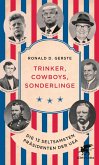Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Deutsch-amerikanische Geschichte: Johannes Ehrmann erzählt von der Familie Mühlenberg
Vor wenigen Wochen war es wieder so weit: Jedes Jahr am dritten Samstag im September versammeln sich allerhand bunte Trachtentruppen und Musikvereine, viele davon aus Deutschland angereist, auf New Yorks Fifth Avenue zur traditionsreichen Steubenparade. Benannt wurde der Umzug, mit dem die deutschstämmigen Amerikaner an ihre Geschichte erinnern wollen, nach dem preußischen General Friedrich Wilhelm von Steuben, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als Generalstabschef in George Washingtons Armee kämpfte. Würde man unter Amerikanern nach dem bekanntesten Deutschen aus der Zeit der Staatsgründung fragen, so dürfte sein Name wahrscheinlich am häufigsten fallen.
Doch verdecken die Erinnerung an Steuben und das gar nicht so traditionsreiche Gedenken an ihn - die New Yorker Parade gibt es erst seit 1957, noch jüngeren Datums sind weitere wie die in Chicago oder Philadelphia - andere prägende deutsch-amerikanische Gestalten des achtzehnten Jahrhunderts. Dazu zählen der 1711 im niedersächsischen Einbeck geborene lutherische Pastor Heinrich Melchior Mühlenberg und drei seiner Söhne. Mühlenberg kam 1742 in die damaligen überseeischen Kolonien, nachdem die deutschen Siedler in der Gegend um Philadelphia bei ihrer Kirche nach einem ordentlich ausgebildeten Pfarrer verlangt hatten. Vermittelt hatte diesen Auftrag der damalige Direktor und Sohn des Gründers der Franckeschen Stiftungen in Halle, Gotthilf August Francke. Francke und die Stiftungen sollten einer der Anker in Mühlenbergs Leben bleiben. Annähernd fünfzig Jahre hielt die Korrespondenz, die schon vor Jahren ediert, bislang aber vor allem für kirchenhistorische Forschungen herangezogen wurde. Johannes Ehrmanns Buch zeigt, welch reichhaltige alltags-, kultur- und politikgeschichtliche Quelle die Briefe aber ebenfalls sind.
Den kirchenhistorischen Hintergrund sollte man sich allerdings vergegenwärtigen, bevor man "Söhne der Freiheit" aufschlägt. Denn die im Untertitel benannte "deutsche Einwandererfamilie" ist eben zunächst eine Pfarrfamilie. Die Darstellung handelt daher ausführlich vom mühseligen Aufbau von kirchlichen Gemeindestrukturen, wozu nicht zuletzt der Bau von Schulen und Kirchen gehörte - darunter die seinerzeit größte protestantische Steinkirche in Nordamerika, die Zionskirche in Philadelphia. Während der tatkräftige Pastor bei Wind und Wetter zu seinen weit im Land verteilt wohnenden Schäfchen reist, bleibt seiner Frau der beschwerliche Alltag einer oft mit ihren insgesamt sieben Kindern allein zu Hause zurückgelassenen jungen Mutter. All dies vor dem Hintergrund immer neuer Kriege und grausamer Auseinandersetzungen an der sogenannten "Frontier", in deren Verlauf der Vater entscheidet, drei der Söhne zur Ausbildung zurück nach Deutschland zu schicken und in die Obhut Gotthilf Franckes zu geben. Diese drei sind es, Johann Peter, Friedrich August und Heinrich Ernst, die zu bedeutenden Akteuren der amerikanischen Revolution werden sollten. An ihren Lebensläufen schildert Ehrmann die Dynamik der Zeit. Denn alle drei sollten in die Fußstapfen des Vaters treten und wurden zu Pfarrern ordiniert, bevor sie andere Wege einschlugen. Der älteste, Peter, schloss sich George Washington an und kämpfte in der Schlacht von Yorktown als Brigadegeneral an seiner Seite. Später wurde er mehrfach in das Repräsentantenhaus gewählt, ebenso wie sein Bruder Friedrich, der 1789 sogar dessen erster Speaker wurde. Nur den jüngsten der drei, Heinrich, hielt es im Pfarrberuf. Bis heute bekannt ist er allerdings durch seine botanischen Studien, die ihm die Aufnahme in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina einbrachten. Zu seinem weitgespannten Netzwerk zählte sogar Alexander von Humboldt, der ihn auf seiner Amerikareise 1804 gemeinsam mit Aimé Bonpland besuchte.
Die "Muhlenberg family" wird bis heute genannt, wenn es um große amerikanische Familiendynastien geht. Ehrmann will an ihren ersten beiden Generationen zeigen, wie groß der deutsche Beitrag zur Gründung der Vereinigten Staaten war - nicht nur zahlenmäßig, machten doch die Deutschen die größte Einwanderergruppe aus, sondern auch durch ihr Wirken in der Öffentlichkeit, durch eigene Zeitungen, durch militärischen Einsatz oder durch politische Einflussnahme. Nicht zuletzt verdankten die Mühlenbergs ihre politischen Erfolge der Tatsache, dass sie durch ihr Ansehen unter den deutschen Einwanderern deren Stimmen zu sichern halfen. Anschaulich zeichnet Ehrmann die Gewissenskonflikte der Söhne nach, als sie aus dem religiösen Horizont ihres Vaters hinausgezogen werden und sich für politische Ideale wie Freiheit und unveräußerliche Grundrechte begeistern. So kommt es, dass mit Friedrich Mühlenberg ein in Halle an der Saale ausgebildeter Pastor zu den Erstunterzeichnern der Bill of Rights gehört.
All dies fügt Ehrmann zu einer lebendigen Erzählung zusammen, mit Sinn sowohl fürs Detail wie auch für die großen historischen und politischen Zusammenhänge. Dabei schildert er ohne Skandalisierung die Umstände, die eben der Zeitgenossenschaft geschuldet waren: Auch die Mühlenbergs hatten Haussklaven, auch die Mühlenbergs bemühten sich nach der amerikanischen Unabhängigkeit um Eigentumstitel für Land, das der indigenen Bevölkerung gestohlen wurde. So ging die Geschichte der Deutschen in Amerika allmählich ganz in der Geschichte der Vereinigten Staaten auf. SONJA ASAL
Johannes Ehrmann:
"Söhne der Freiheit". Eine deutsche Einwandererfamilie
und die Gründung der Vereinigten Staaten.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2023. 320 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main