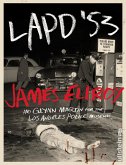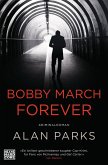Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Krimis in Kürze: Marcie Rendon, Un-Su Kim und Leonard Bell
Native Americans gehören nicht gerade zu den Stammgästen in amerikanischen Kriminalromanen - allenfalls als Delinquenten. Tony Hillerman immerhin hat vor Jahren mit einigem Erfolg Navajo-Polizisten in New Mexico ermitteln lassen; an der Repräsentation der ethnischen Minderheit und ihrer Lebenswelten hat das allerdings nicht viel geändert.
Auch Marcie Rendon, achtundsechzig Jahre alt und Angehörige der im nordwestlichen Minnesota beheimateten White Earth Nation, dürfte das kaum gelingen. Aber das ist kein Grund, ihre Bücher nicht zu lesen. Der Roman "Stadt, Land, Raub" (Ariadne im Argument Verlag, 240 S., br., 13,- [Euro]) ist bereits die zweite Begegnung mit Renee Blackbear, die es vorzieht, "Cash" genannt zu werden. Sie ist knapp zwanzig Jahre alt, lebt in Fargo, North Dakota, das wir seit dem gleichnamigen Film der Coen-Brüder und der Serie alle kennen, geht inzwischen aufs College, arbeitet nachts als Lkw-Fahrerin, spielt bei jeder Gelegenheit Poolbillard und trinkt manchmal auch mehr Bier, als es gut ist für sie.
Cash ist keine klassische Ermittlerin, sie gerät über ihren Mentor, den örtlichen Sheriff Wheaton, in einen Fall. Aber ihre Biographie ist exemplarisch für zahlreiche Native Americans um 1970, in der Zeit, in der Rendons Romane spielen. Sie hat mehr als eine Pflegefamilie überlebt, die Spur von Geschwistern und Eltern verloren, sie weiß, was Missbrauch ist und wie alltäglicher Rassismus funktioniert. Mit ihren 1,58 Metern Größe und ihrem fotografischen Gedächtnis ist sie dennoch keine indianische Lisbeth Salander, auch keine erwachende Aktivistin, obwohl ihr am College Leute vom American Indian Movement begegnen. Sie ist eine junge White-Earth-Frau, die ihren Weg sucht, und Marcie Rendon erzählt von ihr und ihrer Welt auf eine so lebendige, zugewandte Weise, dass man sehr gerne zuhört.
Auch Südkorea ist nicht gerade eine vertraute Krimiregion, wenngleich es in den letzten Jahren einige starke Auftritte gab. Unter anderem von Un-Su Kim, der jetzt mit "Heißes Blut" (Europa Verlag, 582 S., geb., 24,- [Euro]) zum zweiten Mal ins Deutsche übersetzt wird - leider aus dem Französischen, was darauf schließen lässt, dass da einiges lost in translation ist. Die Gangster-Story aus Busan ist koreanisches Noir, und wer schon einmal einen koreanischen Kriminalfilm gesehen hat, der hat eine brauchbare Vorstellung von der Härte und Unbarmherzigkeit, mit der in diesem Milieu die Dinge geregelt werden.
"Heißes Blut" erzählt vom ehemaligen Boxer Huisu, der sich vom geizigen Unterwelt-Boss Vater Son löst, um seine eigenen Geschäfte zu machen. Glamouröse Gangster sehen anders aus, Huisu ist um die vierzig, neigt zu Depression und Magenproblemen, zockt zu viel und liebt unglücklich die Prostituierte Insuk. Aber er ist noch immer skrupellos und brutal genug, um nicht unter die Räder zu kommen.
Das Faszinierende an Kims Roman ist, dass er ein in sich geschlossenes Universum beschreibt. Ein bürgerliches oder ziviles Jenseits zu Ökonomie und Konkurrenz der Gangsterbanden scheint es so gut wie gar nicht zu geben, so wenig wie einen Staatsapparat, der in der Lage wäre, mehr als nur ein paar Gefängnisstrafen durchzusetzen.
Weder hart noch augenöffnend dagegen ist "Der Petticoat-Mörder" (Ullstein, 432 S., br., 9,99 [Euro]) von Leonard Bell. Sondern bloß exemplarisch dafür, wie ein historischer Berlin-Roman nicht sein sollte. Warum der Autor unter Pseudonym schreibt, ist unklar; dass seine "heimliche Leidenschaft" (Verlagsangabe) für die fünfziger Jahre nicht immer mit leidenschaftlicher Recherche verbunden ist, wird dagegen schnell klar, wenn schon anfangs einer im Jahr 1958 von Tegel aus nach Westdeutschland fliegen soll; und wenn die Bürgergattin ihre allmorgendlichen Croissants verzehrt, ist das gewissermaßen avant la lettre.
Auch sonst bleibt die Geschichte um den jungen Kripo-Quereinsteiger Fred Lemke und die alten Nazis im Polizeiapparat weitgehend spannungsfrei und wird auch wenig plausibel aufgelöst. Der Titelzusatz "Fred Lemkes erster Fall" ist keine Ankündigung, auf die man gewartet hätte.
PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH