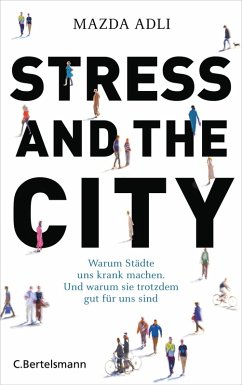Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Katharina Granzin (kgr)

Stress ist nicht alles: Der Psychiater Mazda Adli sichtet die Kritik am aufreibenden Leben in großen Städten.
Der Mensch, so predigen es die Evolutionspsychologen, ist für das Leben in Kleingruppen gemacht. 25, vielleicht 50, maximal 100 Menschen, alles darüber hinaus ist Stress. Und doch lebt weltweit jeder zweite Mensch in einer Stadt, 2050 werden es 70 Prozent sein. Und viele dieser Städte dürften dann Megacitys sein, Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Die Urbanisierung sei die markanteste Veränderung in der Geschichte der Menschheit, schreibt der Psychiater und Psychotherapeut Mazda Adli: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung drängt sich auf zwei Prozent der Erdoberfläche zusammen.
Glaubt man den Evolutionspsychologen, kann dies nur in einer Katastrophe enden. Und darauf deutet, wie Adli gleich zu Beginn darlegt, in der Tat einiges hin: Stress ist zu einem Dauerthema geworden, Stressfolgekrankheiten seien zu Volkskrankheiten geworden. Eine in der Stadt verbrachte Kindheit erhöhe nachweislich das Risiko, etwa an Schizophrenie zu erkranken. Alles richtig, bekundet der Autor, dennoch lebe er gerne in der Stadt. Und so hat er sich auf die Suche nach ihren Vorzügen gemacht. Dabei ist ein vielseitiges Buch entstanden: über den Stress, seine physiologischen Hintergründe, seine städtischen Auslöser wie Enge, Lärm, Verkehrsgewühl, schlechte Luft und die Angst vor dunklen Ecken, aber auch über Strategien, mit all dem umzugehen. Alles unterlegt mit den persönlichen Erfahrungen Adlis, der in so unterschiedlichen Städten wie Berlin, Teheran und New York gelebt hat, und ergänzt um Interviews mit Künstlern, Wissenschaftlern, Medizinern und Stadtplanern.
Für die Stadt, so konstatiert der Autor nüchtern, spricht als Erstes, dass es dort Arbeit gibt, jedenfalls mehr als auf dem Dorf. Viele träumen vom Leben im Grünen, können aber schlicht nicht weg. Ein zweites Argument für die Stadt: Auf dem Land ist es auch nicht besser. Im Gegenteil sei die idyllische Kindheit, in der durch Wiesen getobt und auf Bäume geklettert wurde, auch auf dem Land seltener geworden, und ob das Dorf mehr interessante Spielmöglichkeiten habe als die Stadt, sei fraglich. Zudem sei die Kindersterblichkeit höher, die Betreuungssituation schlechter, die Auswahl an Schulen und Freizeitangeboten geringer, vom öffentlichen Nahverkehr ganz zu schweigen.
Weil die Ärzte so weit weg sind, ist die Wahrscheinlichkeit, am Herzinfarkt zu sterben, höher, die Wahrscheinlichkeit, eine richtige Diagnose zu bekommen, dagegen niedriger, Therapieplätze seltener. Also, all ihr naturträumerischen Städter: Hört auf, das Land zu romantisieren! In der Stadt pflege der Mensch zudem größere soziale Netze und profitiere, das ist Adlis wichtigstes Argument für das Leben in der Stadt, von den vielen Anregungen, die sie ihren Bewohnern bietet: die Vielfalt der Menschen und Lebensformen, das kulturelle Angebot. Das Eigene werde immer wieder herausgefordert und in Frage gestellt, wodurch die lebendige, mitreißende Stimmung entstehe, für die es sich in der Stadt zu leben lohne.
Daran ist zweifellos etwas Wahres, doch was die dunklen Seiten der Städte angeht, hat der Autor keine guten Argumente. Die Stadt ist stressig? Dafür gibt es gar kein verbindliches Maß. Die Stadt ist laut? Schon, aber wer sich klarmache, warum ein Lärm entstehe, den störe er schon nicht mehr so stark. Das Gehirn des Städters reagiert überempfindlich? Nein, es ist durch den ganzen Stress nur besser trainiert. Die Stadt überfordert einen mit ihrer Reizüberflutung? Vielleicht gehört man einfach nicht zu den "städtischen Persönlichkeiten" oder hat sich nicht ausreichend bemüht, sich die Stadt "anzueignen". Was der Mensch als stressig empfindet, hänge eben davon ab, wie er etwas beurteilt, konstatiert der Autor. Wer die kurzen Wege und das breite Angebot schätze, den störe das Negative weniger, und ein Kind, das in der Stadt aufwachse, sei flexibel genug, die nötigen Überlebensstrategien zu lernen. Aus seiner therapeutischen Praxis, in der der Autor auch mit Menschen zu tun hat, die sich in der Stadt so gar nicht wohl fühlen, gibt er ein paar Tipps für die nötigen Großstadtskills: nachgeben, einlenken, flexibel sein, das Spektakel als eine Kulisse des eigenen Lebens begreifen.
Adli argumentiert genaugenommen nicht, dass "die Städte" gut für uns sind, sondern, dass sie gut für uns wären, wenn sie gute Städte wären. Gute Städte, darin kommt der Autor den Vorstellungen der Evolutionspsychologen durchaus entgegen, sind sicher, kleinräumig, grün, mit Radwegen und Platz zum Flanieren. Gute Städte sind offene Städte im Sinne Richard Sennetts: keine blitzsauberen Reißbrettkonstrukte, sondern unvollkommene Städte, die von ihren Bewohnern geprägt werden können, die Zentren haben, ihre Geschichte erkennen lassen, die Fremde willkommen heißen, in der Teilhabe und Wohnen für Normalsterbliche finanzierbar sind und die nicht den aktuellen Tendenzen der sozialen Segregation erliegen.
Ist all das erfüllt, mag man gerne glauben, dass schon die bloße Möglichkeit, eins der vielen Konzerte oder Theater zu besuchen, in einer der zahllosen Kneipen zu sitzen, mit all den fremden Menschen ins Gespräch zu kommen, ausreicht, um die Stadt zu einem faszinierenden Ort zu machen. Nur, dass die Realität in den meisten Vierteln der meisten Städte für die meisten Menschen anders aussieht. Am überzeugendsten ist das Buch deshalb als Plädoyer, die Städte besser, menschengemäßer zu gestalten.
MANUELA LENZEN
Mazda Adli: "Stress and the City". Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind.
C. Bertelsmann Verlag,
München 2017. 384 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main