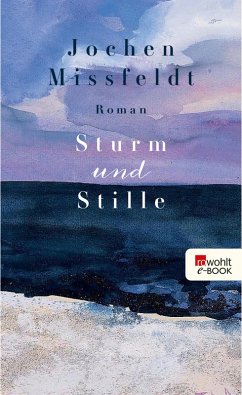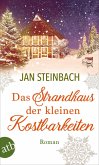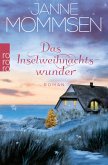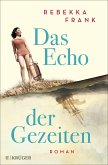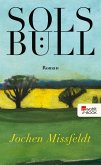Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Im Licht der aktuellen biographischen Forschung: Jochen Missfeldts Roman "Sturm und Stille" über Theodor Storm und seine Frauen verleiht einer bislang stummen Geliebten eine Stimme.
Wahre Liebe, heißt es, könne warten. Eine Geduldsprobe von zwanzig Jahren dürfte allerdings die meisten Leidenschaften verschleißen. Doris Jensen war jedoch eine Langstreckenläuferin der Liebe. Der Geliebten Theodor Storms und ihrer Passionsgeschichte hat der Schriftsteller und ehemalige Bundeswehrpilot Jochen Missfeldt ("Sollsbüll" und "Gespiegelter Himmel" sind seine bekanntesten Werke) im Storm-Jubiläumsjahr nun einen biographischen Roman gewidmet.
In einem rückblickenden Bekenntnis-Brief aus dem Jahr 1866 hat Storm geschildert, wie er von der Liebe zu der elf Jahre Jüngeren ergriffen wurde. Er hielt die 1828 geborene Doris für dreizehn; sie war fünfzehn. Zweifellos ein Lolita-Moment der deutschen Literaturgeschichte: "Aber bei jenem Kinde . . . da war jene berauschende Atmosphäre, der ich nicht widerstehen konnte."
Theodor Storm war ein Erotiker; seine Liebesgedichte gehören zu den schönsten, ergreifendsten der deutschen Literatur. Nicht wenige von ihnen verdanken sich der Leidenschaftserfahrung mit Doris Jensen. Auch wenn die Dokumente sonst spärlich sind - mit diesem lyrischen Material kann Jochen Missfeldt, der bereits eine große Biographie Storms geschrieben hat und sich auf die Hintergründe dieses Lebens versteht, gut arbeiten und erzählen. Auch atmosphärische Reize - Heideduft, Sommerluft, Laufkäfer im Gesträuch - entnimmt Missfeldt der Lyrik Storms.
Viele Figuren, Anekdoten und Motive seines Buchs bezieht er dagegen aus Storms Novellen. Einfühlung und intertextuelles Spiel sind die Erzählstrategien dieses Romans. Bei der ersten intimen Begegnung etwa (Doris war achtzehn und Storm bereits mit seiner späteren Frau Constanze verlobt) zitiert Missfeldt eine Liebesszene aus der Novelle "Aquis submersus". Die sympathische Figur des Hegereiters Erichsen wiederum, bei dem das Paar später eine Zuflucht findet, hat ihr Vorbild in der Figur des "Vetters" aus Storms Erzählung "Eine Halligfahrt".
"Sturm und Stille" ist eine große Liebes- und Entsagungsgeschichte, auch wenn die Leidenschaft in Missfeldts Prosa gedimmt bleibt, was auch daran liegt, dass er Doris aus dem abgeklärten Rückblick erzählen lässt. Bei der Schilderung eines Frauenlebens aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts besteht die Gefahr, die Ich-Erzählerin zu sehr aus heutiger Sicht denken zu lassen, als hätten die jungen Damen um 1850 schon die Sehnsucht nach der Geschlechterordnung von 2017 gehabt. Missfeldt lässt seine Heldin zwar durchaus mit den Beschränkungen der damaligen Frauenexistenz hadern, aber er verleiht ihr zugleich ein glaubwürdiges zeitgenössisches weibliches Selbstverständnis. Leidensfähigkeit wurde als Tugend begriffen; sie war auch gefordert angesichts der lebensgefährlichen Schwangerschaften. Tief eingeprägt haben sich Doris die Maximen der Madame Frisé aus Flensburg ("Geradität und Selbstbeherrschung") und die fatalistische Lebensweisheit ihrer Mutter: "Es muss gegangen sein."
Die Erziehung junger Frauen hatte der Vorbereitung auf die Ehe zu dienen. Als Storms Schwester Cäcilie erwägt, Lehrerin zu werden, warnt der Vater: "Wenn du Lehrerin werden willst, kriegst du keinen Mann - gelehrt ist verkehrt." Ein großes Stigma bestand darin, "eine Sitzengebliebene" zu sein, eine "Mamsell" und "alte Jungfer". Noch heikler war es allerdings, zu den zu früh Aufgestandenen zu gehören. Auch wenn die Sehnsucht zu ihrem Grundgefühl wird, ist Doris in Missfeldts Darstellung nicht auf Depression und Seufzerton gestimmt, sondern auf die Bewältigung ihres Paria-Lebens. Die Husumer Gesellschaft verbannt sie, weil Storm nicht von ihr lassen kann und sie nicht von ihm. Um den guten Ruf des Anwalts und dessen Ehe mit Constanze zu retten, muss Doris verschwinden.
Die darauf folgende Odyssee wird in der zweiten Hälfte des Romans beschrieben. Doris schlägt sich als Haushaltshilfe fern in der Provinz durch. Dabei gewinnt sie ein ums andere Mal Einblicke in menschliche Abgründe. Die schwarze Komik à la Wilhelm Busch hat ihre erste Station beim Pastor Petrus Plagemann. In dessen Haus ist der Tag streng eingeteilt, von der ersten Morgenandacht bis zur abendlichen "Generalbuße". Im nördlichen Fobeslet erlebt Doris das tödliche Ehedrama von Schloss Holkenis aus unmittelbarer Nähe mit, von dem Fontane im Roman "Unwiederbringlich" erzählt. Nach dem Selbstmord der Gräfin zieht Dorothea nach Flensburg, wo sie es mit einer weiteren Außenseiterin und Entsagenden zu tun bekommt: der uralten, steinreichen Botilla Jansen, die sich in ihrem Haus von der Außenwelt abgekapselt hat - Storm-Leser erkennen sie als Hauptfigur der dunklen Novelle "Im Nachbarhause links" wieder. Von der unheimlichen Wildheit, Verzweiflung und Paranoia der Alten bleibt bei Missfeldt allerdings wenig, wenn Botilla und Doris gemeinsam die Obsternte zu Marmelade und Kompott verarbeiten.
Sie habe sich immer zu helfen gewusst, resümiert Doris; in schweren Stunden sei sie auf den Deich gegangen, habe übers Meer geschaut und ihren Trüb- und Tiefsinn "in die Wellen der Nordsee gejagt". Die Tendenz ist deutlich. In der neueren Storm-Forschung, schreibt Missfeldt im Nachwort, werde Doris Jensen zu einseitig als Opfer und Leidende gesehen; die wenigen Lebenszeugnisse aber brächten eher ihre grundsätzliche "Lebenszuversicht" und ihren "Sinn fürs Praktische" zum Ausdruck, beides Voraussetzungen dafür, dass nach dem Tod Constanzes doch noch eine glückliche Ehe mit Storm möglich wurde.
Die realen Hintergründe des Romans lassen sich vertiefen im neuen Storm-Handbuch, dessen mehr als sechzig Mitarbeiter die reichhaltige neuere Storm-Forschung repräsentieren. Ausführungen über Storms Wissen, seine dichten Bezüge zur zeitgenössischen Medizin und Biowissenschaft, seine aufgeklärten politisch-gesellschaftlichen Auffassungen sowie über seine Rechtspoetik (immer wieder juristische Probleme und Kriminalfälle in den Erzählungen!) entrücken den Autor dem überkommenen Bild des norddeutschen Heimatschriftstellers und zeigen ihn als intellektuell wachen Protagonisten der Vormoderne, anschlussfähig zudem an heutige Diskurse der Literaturwissenschaft. Wobei der Abschnitt über Sex und Gender in Storms "Codierungen des Geschlechtlichen" vielleicht doch ein wenig übers Ziel hinausschießt. Die inzwischen selbst stereotyp und klischeehaft gewordene Terminologie grenzt hier in Anwendung auf ein Erzählwerk des neunzehnten Jahrhunderts an unfreiwillige Parodie, wenn etwa versichert wird, dass die Figuren in Storms späten Texten vom "hegemonialen, bipolaren Geschlechtermodell abweichen und marginalisierte Männlichkeiten repräsentieren". So die neue Einsicht einer Wissenschaft, die Hauke Haien vor zwei Generationen noch als "nordisch gestaltete Führerpersönlichkeit" begreifen wollte. "Gelehrt ist verkehrt", möchte man da seufzen.
Hiervon abgesehen, bietet der Band jedoch eine Fülle von Storm-Informationen. Die rund fünfzig Novellen werden ausführlich einzeln vorgestellt, in die Werkzusammenhänge eingeordnet und interpretiert: eine ungemein anregende Handreichung für alle, die das grandiose und komplexe Prosawerk Storms auch jenseits des "Schimmelreiters" erkunden möchten.
WOLFGANG SCHNEIDER
Jochen Missfeldt: "Sturm und Stille". Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 352 S., geb., 22,- [Euro].
Christian Demandt, Phlipp Theisohn (Hrsg.): "Storm Handbuch". Leben - Werk - Wirkung.
J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2017. 424 S., geb., 89,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main