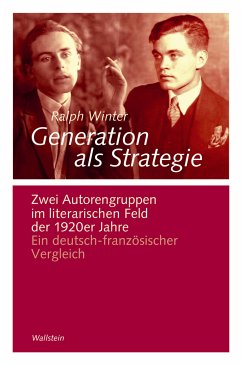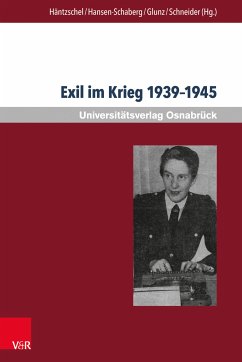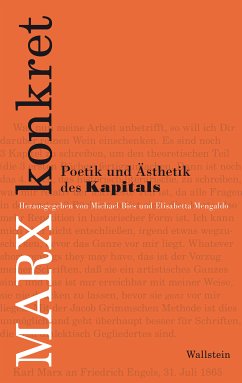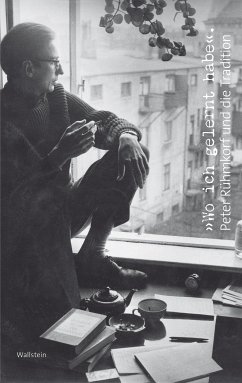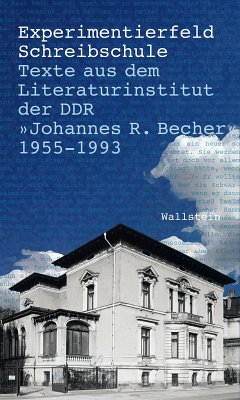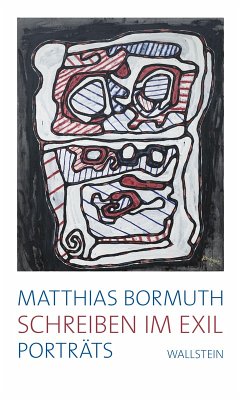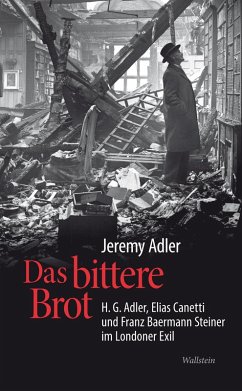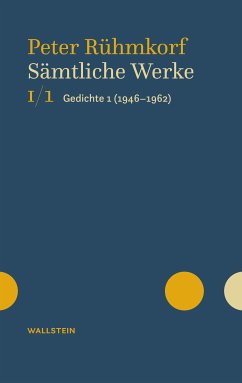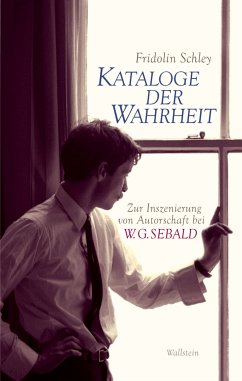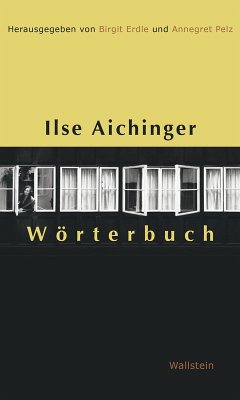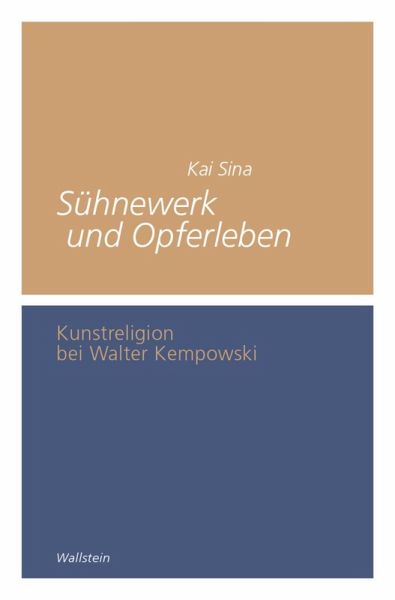
Sühnewerk und Opferleben (eBook, PDF)
Kunstreligion bei Walter Kempowski
Sofort per Download lieferbar
Statt: 29,90 €**
22,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Kempowskis kunstreligiöses Konzept in seiner fast vierzigjährigen Entwicklung. Auf ihm laste ein "verordnetes Lebenswerk", schreibt Walter Kempowski in eines seiner Tagebücher. Diese bekenntnishaften Worte beziehen sich auf den ungeheuerlichen Anspruch, der Kempowskis schriftstellerisches Selbstverständnis von Anfang an und grundlegend bestimmt: der Anspruch, mit seinem aus Romanen, Tagebüchern und monumentalen historischen Textcollagen zusammengesetzten Werk die historische Schuld der Deutschen am Zweiten Weltkrieg zu sühnen. Diese vom Debütroman "Im Block" (1969) bis in dem postum ers...
Kempowskis kunstreligiöses Konzept in seiner fast vierzigjährigen Entwicklung. Auf ihm laste ein "verordnetes Lebenswerk", schreibt Walter Kempowski in eines seiner Tagebücher. Diese bekenntnishaften Worte beziehen sich auf den ungeheuerlichen Anspruch, der Kempowskis schriftstellerisches Selbstverständnis von Anfang an und grundlegend bestimmt: der Anspruch, mit seinem aus Romanen, Tagebüchern und monumentalen historischen Textcollagen zusammengesetzten Werk die historische Schuld der Deutschen am Zweiten Weltkrieg zu sühnen. Diese vom Debütroman "Im Block" (1969) bis in dem postum erschienenen Gedichtband "Langmut" (2009) erstaunlich beharrlich aufrechterhaltene Grundüberzeugung geht einher mit der umfassenden und anhaltenden Überformung der Autorschaft, der Poetik und nicht zuletzt des literarischen Werks im Modus moderner Kunstreligion: Durch sein "Opferleben" vollbringt der Autor ein "Sühnewerk", und nimmt selbst unweigerlich die Stellung eines christusartigen "Vertreters" ein.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.