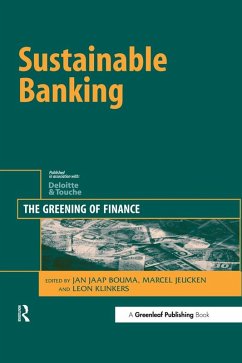Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Moralische Anmaßung versus ökonomische Grundregeln
Jan Jaap Bouma/Marcel Jeucken/Leon Klinkers: Sustainable Banking. The Greening of Finance. Greenleaf Publishing, Sheffield 2001, 480 Seiten, 84 Dollar.
Das Bank- und Finanzwesen gilt nicht gerade als gezielt moralisches Geschäft. Freilich ist der anmaßende Versuch, jene Branche zur Moral zu erziehen, noch weniger attraktiv, wie das Buch über nachhaltiges Bankgeschäft zeigt. In dessen Zentrum steht ein Beitrag von James Guiseppi, der für die Vermögensverwaltungsgesellschaft Henderson Global Investors arbeitet. Henderson lehnt Vermögensanlagen, die mit Tabak, Glücksspiel, Atomkraft und Rüstung in Zusammenhang stehen, als "schlecht" ab. Alle diese Branchen sind legal, aber ihnen wird - ohne Begründung - moralische Minderwertigkeit angehängt. Umgekehrt werden nicht nur Unternehmen positiv bewertet, die in ihrer Branche Spitzenpositionen besetzen, sondern auch solche, die sich sozial hervortun, im Gesundheitswesen, in der Ausbildung, mit erneuerbaren Energien oder im öffentlichen Personenverkehr.
Übersehen wird, daß allein der Vollzug einer Transaktion der beste Nachweis ist, ob die Menschen diese als wohlfahrtsverbessernd betrachten oder nicht. Aber jene Vermögensverwalter geben vor, es besser zu wissen, sogar besser als gewählte Volksvertreter: So seien die Unternehmen so lange nicht zu mehr als dem gesetzlich vorgeschriebenen Umweltschutz bereit, wie Analysten dies nicht zu einem Bewertungskriterium der Kapitalmärkte machten. Damit bleibe der Umweltschutz unter dem sozial optimalen Niveau, schreibt Guiseppi. Das widerspricht allen Erkenntnissen der Public-Choice-Theorie: Zumeist schießt Regulierung über das effiziente Niveau hinaus. Zusätzliche Beschränkungen können da wenig zur allgemeinen Wohlfahrt beitragen.
Im übrigen sind gegenüber den angeblich moralisch wertvollen Branchen Zweifel angebracht. So mag man die Photovoltaik zur "erneuerbaren Energie" zählen. Dabei ist die Herstellung von Sonnenkollektoren ökologisch nicht unbedenklich. Umgekehrt hat kaum ein Wirtschaftszweig so viel dazu beigetragen wie die Automobilindustrie, daß breite Schichten in Freiheit und Wohlstand leben. Dennoch gilt der öffentliche Personenverkehr als moralisch überlegen. Angesichts der Schuldenlast der Entwicklungsländer ruft Guiseppi die Anleger dazu auf, ihr Geld allein in "sozial verantwortliche Projekte mit nachhaltigen Finanzierungskonditionen" zu stecken. Freilich wäre es wohl kaum zu einer Schuldenkrise des gegebenenen Ausmaßes gekommen, wenn die Banken klassische Bonitätsprüfungen vorgenommen hätten, statt sich auf Regierungsgarantien zu verlassen.
Björn Stigson, Vorsitzender des World Business Council for Sustainable Development, versucht sich in einem weiteren Beitrag an der Quadratur des Kreises zwischen Rentabilität und Nachhaltigkeit. Dabei vermag niemand mehrere Ziele gleichzeitig zu erreichen. Diese mögen sich eine Weile parallel verfolgen lassen, doch irgendwann geraten sie in Konflikt, und es heißt Prioritäten setzen. Ein Anleger mag so lange nicht gegen eine Portfoliostrategie opponieren, wie die Rendite noch ansehnlich ist. Wenn die Erträge aber abrupt fallen, folgt die Umorientierung auf dem Fuße; Renditekalkül triumphiert über Nachhaltigkeit.
Stigson ruft nach einer Steuerpolitik und Regulierung, die nachhaltige Unternehmen hinterrücks auch zu den profitabelsten macht. Für ihn sind Ökosteuern und ähnliche ökologische Lenkungsmechanismen durch die Abweichung zwischen privaten und sozialen Kosten ("externe Effekte"), die es zu "internalisieren" gelte, gerechtfertigt. Dabei übersieht er freilich, daß negativen Externalitäten zumeist auch positive gegenüberstehen - und daß manche Kosten überhaupt erst in Anpassung an staatliche Regulierungen externalisiert werden.
Sein Fazit: "Reine kurzfristige Profitabilität reicht nicht mehr." Das hat sie nie getan. Viele Unternehmen zielen darauf, ihren Firmenwert oder Marktanteil zu maximieren. Das zahlt sich aus - wenn sie mit ihren Produkten Menschen erreichen, die die verlangten Preise zu zahlen bereit sind. Es ist besorgniserregend, daß es gerade auf den Finanzmärkte tatsächlich Nischen gibt, in die jene Erkenntnis noch nicht vorgedrungen ist.
BERNARD ROBERTSON
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main