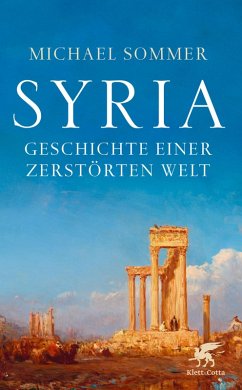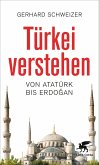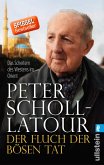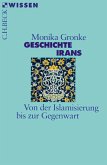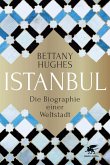Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Michael Sommer führt durch die syrische Geschichte
Nach der Lektüre von Michael Sommers Buch "Syria" ist man beinahe ein bisschen traurig, dass es offenbar erst der Zerstörungswut des "Islamischen Staates" als eines Anlasses bedarf, um die kulturhistorische Bedeutung dieser Region einem breiteren Lesepublikum nahezubringen. Getrost vergessen darf man darum die Versuche, dem Buch eine Aktualität à la "Brückenschlag zwischen Gegenwart und Antike" anzudichten - einigen Überlegungen des Autors im Nachwort über langfristige Kontinuitäten und Parallelen zum Trotz.
Die zweitausend Jahre alte Welt, die er auf knapp zweihundert Seiten beschreibt, ist es für sich genommen wert, beschrieben zu werden. Zumal wenn man, wie der in Oldenburg lehrende Althistoriker, Ereignis- und Strukturgeschichte gleichermaßen berücksichtigt und darüber hinaus auch methodologische und geschichtstheoretische Erörterungen elegant einwebt. Seinem aus sechs wichtigen "Schauplätzen" des antiken Syriens zusammengesetzten Mosaik - von Issos über Jerusalem, Hatra, Emesa und Palmyra bis Antiocheia - hat er ein Kapitel über die "Macht der langen Dauer" vorangestellt, in dem er die wichtigsten Kräfte skizziert, die im östlichen Mittelmeerraum über Jahrhunderte zusammen- und gegeneinander wirkten: Imperien, Stämme und Erinnerungskulturen.
Die Levante sieht er als "Transitregion par excellence"; ein Knotenpunkt des frühen Welthandels und zugleich ein Konfliktfeld, in dem sich meist die Ansprüche mehrerer Großreiche überschnitten, seien es die der Seleukiden, der Römer oder der Parther. In den Zentren dieser Region entwickelten sich urbane Kulturen, geprägt durch das oft symbiotische Verhältnis von Nomaden und Sesshaften und tief beeinflusst von der hellenischen Kultur, die nach Alexanders Sieg 333 vor Christus über die Perser in Gestalt griechischer Migranten in den Nahen Osten kam. Griechischsein war fortan "eine Frage des Habitus" und das Ideal, jedoch kein Kulturtransfer, der nur in eine Richtung verlaufen wäre.
Zumal sich - was sich vor allem am Beispiel fundamentalistischer jüdischer Strömungen in Jerusalem zeigt - immer wieder lokale Traditionen gegen die Vereinnahmung durch diese Vormacht sperrten. Nicht immer kam es jedoch zu katastrophalen Gewaltausbrüchen wie beim jüdischen Aufstand ab dem Jahr 66. Oft funktionierte die Integration verschiedener kultureller und politischer Einflusssphären den erhaltenen Quellen zufolge erstaunlich gut und brachte beeindruckende zivilisatorische Zeugnisse hervor.
Nebenbei lernt man einiges darüber, mit welchen Strategien die antiken Imperien ihre Randgebieten zu sichern suchten; und umgekehrt, wie lokale Vasallen dies für sich nutzen konnten. Etwa der Palmyrener Odaenathus, der 260 fast im Alleingang die bedrängte römische Herrschaft gegen die Perser verteidigte, vermutlich mit der Hilfe verwandtschaftlich verbundener Stammeskrieger. Leute wie er waren "in unterschiedlichen Welten zu Hause", sie entstammten der regionalen Oberschicht am Rande der Wüste, verstanden und inszenierten sich aber ebenso als römische Würdenträger, wenn es angebracht erschien. Sommer nennt sie "kosmopolitische Netzwerker", und dass in einer solcherart multikulturellen Welt schließlich auch das Christentum mit Leichtigkeit in die paganen Traditionen integriert werden konnte, überrascht keinesfalls mehr.
CHRISTIAN MEIER
Michael Sommer:
"Syria". Geschichte einer zerstörten Welt
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2016. 217 S., br., 16,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main