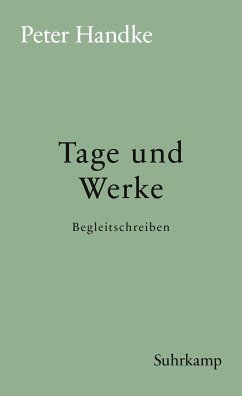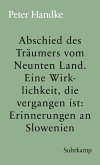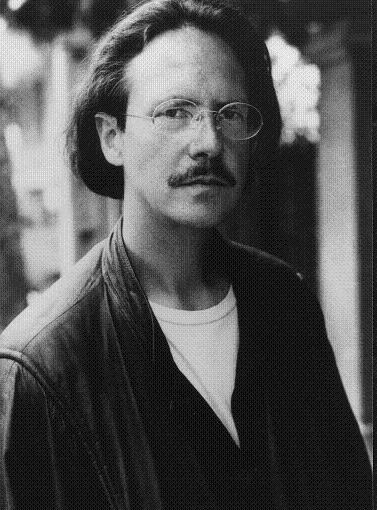Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Warum hielt Peter Handke 1966 seine legendäre Schmährede in Princeton? Die Textsammlung "Tage und Werke" birgt dazu wichtige neue Antworten.
In die Stille nach der Lesung hinein meldet er sich zu Wort. Seine Stimme schwankend, stockend, als müsste sich der Sprecher tastend den Weg durch die auf einem Zettel notierten Sätze bahnen. Für einen Augenblick droht die Stimme sogar in den mühsam gebändigten Dialekt zu kippen. Im kommenden April ist es genau fünfzig Jahre her, dass sich Peter Handke auf diese Weise bei der Tagung der Gruppe 47 in Princeton zu Wort meldete und damit nicht nur als Autor die öffentliche Bühne betrat, sondern zugleich die Geschichte der Literatur und Literaturkritik um einen großen Moment und ein unvergessliches Unwort bereicherte. "Beschreibungsimpotenz" bescheinigte er der deutschen Literatur: "Man sucht sein Heil in einer bloßen Beschreibung, was von Natur schon das Billigste ist, womit man überhaupt nur Literatur machen kann. Wenn man nichts mehr weiß, dann kann man immer noch Einzelheiten beschreiben. Es ist eine ganz, ganz unschöpferische Periode in der deutschen Literatur doch hier angebrochen." Und weil er gerade schon die Autoren abgewatscht hatte, gab er gleich auch noch den Literaturkritikern einen mit: "Und die Kritik - ist damit einverstanden, weil eben ihr überkommenes Instrumentarium noch für diese Literatur ausreicht, gerade noch hinreicht. Weil die Kritik so läppisch ist wie diese läppische Literatur. Wenn nun eine neue Sprachgestik auftaucht, so vermag die Kritik nichts anderes, als eben zu sagen, entweder das ist langweilig, sich in Beschimpfungen zu ergehen oder auf gewisse, einzelne Sprachschwächen einzugehen, die sicher noch vorhanden sein werden." Läppisch, impotent, unschöpferisch, das traf die anwesenden Damen und Herren der literarischen Schöpfung - mitten ins Mark. Zwei unterschiedliche Bewertungen des epochemachenden Auftritts konkurrieren seither miteinander: Bereits direkt während der Tagung brodelte der Selbstvermarktungsverdacht auf. Noch Helmut Böttiger vertritt in seiner Studie über die Gruppe 47 diese These. Er bewundert, wie gekonnt es dem angeblich beatleesk auftretenden Handke gelungen sei, "die Geburt einer deutschen Popkultur aus dem Geist der Gruppe 47" zu zelebrieren. In wenigen Minuten öffentlicher Aufmerksamkeit habe Handke seinen Markenkern erfunden. Um die Literatur sei es ihm dabei nicht gegangen. Vielmehr um Autorenkult, wie ihn seither die Popkultur zelebriere. Nur: wenn es Handke nur um den Furor ging, warum dann in so verzärtelter Sprechweise?
Die zweite Lesart hat zuletzt der Germanist Jörg Döring in seiner scharfsinnigen Analyse von Böttigers Gruppenhistorie verfochten: Nicht als Werbecoup sei Handkes Auftritt zu werten, sondern als "die Emanzipation des Autors gegenüber dem Nachkriegsregime der Kritik". Handke habe sich, nachdem er am Tag zuvor seinen eigenen Text vorgelesen habe, als Erster in der Gruppe 47 der Kritik nicht mehr widerspruchslos gebeugt. Mit einem Tag Verspätung habe er sich gegen die als ungerechtfertigt empfundene Kritik gewehrt. Dörings Lesart schwächt den Marketingverdacht zugunsten einer inhaltlichen Auseinandersetzung über die Zukunft der Literatur ab. Allerdings kommt Handke so die Rolle der beleidigten Leberwurst zu. Ein Mann, dem es noch tags drauf die Stimme verschlägt und der um sich schlägt, obwohl sein eigener Text selbst wie alte Beschreibungsliteratur anmutete.
Das Schöne dieser Tage ist: Mit dem Erscheinen von Peter Handkes neuem Buch "Tage und Werke. Begleitschreiben zu Büchern und Autoren" lässt sich dieser Kristallisationspunkt der deutschen Literatur- und Literaturbetriebsgeschichte neu bewerten. Denn der Band versammelt neben einem Sammelsurium von längst gehaltenen Dankesreden, vor Jahren publizierten Geburtstagsgrüßen, öffentlich gemachten Obamahoffnungsseufzern, bekannten Suhrkamp-Streitbriefen und nicht immer treffsicheren Lektürenotaten (zu Autoren wie Brinkmann, Tranströmer oder Mayröcker) einen Schatz. Er besteht aus jenen Sendemanuskripten des ORF, die Handke als Literaturkritiker zwischen Dezember 1964 und September 1966 für das "Landesstudio Graz" verfasste. Es ist hochinteressant, was Handke alles liest, und vor allem, wie er bewertet. Für manche Sendungen fräst er sich durch komplette Verlagsprogramme, für andere verbeißt er sich in eine einzelne Theorie von Barthes oder Adorno. In allen Kritiken aber sucht Handke nach genau jener Angemessenheit, nach dieser vollständig anderen Sprache, um Texten gerecht zu werden. So setzt seine erste Sendung im Dezember 1964 mit einer Kritik zu Cesare Paveses "Der schöne Sommer" ein. Aber weder mit seinem Beschreibungsvokabular für die Sprache (einfach, anmutig, sparsam, schlicht) noch für die Handlung (Mädchen, Sommer, Liebe, Erfahrung) zeigt Handke sich zufrieden. Deshalb schmäht er sich selbst: "Indes sind alle diese Vokabeln so nichtssagend, wie sie gedankenlos sind. Die Literaturkritik wertet, für die Bewertung aber besteht in der Sprache nur ein begrenzter Vorrat von Worten; dieser Vorrat schießt automatisch in die Gedanken, wenn die Sprache des zu beurteilenden Textes beurteilt werden soll: das ist es, was die Literaturkritik oft zu einem leeren Geschäft macht." Die Passion des Kritikers Handke lautet: "Es sind auch andere Sätze möglich." Über zwei intensive Jahre und über den Auftritt in Princeton hinweg treibt diese Suche nach der Beschreibungspotenz gegenüber der Literatur Handke um. Böttiger hat recht, wenn er unterstellt, dass Handkes Auftritt einen langen Vorlauf hatte. Und auch Döring hat recht: Was Handke während der Tagung an Kritik einstecken musste, wird ihm ordentlich gegen den Strich gegangen sein. Aber weniger, weil es ihm um den eigenen Text geht, sondern um die Suche nach einer neuen Sprache der Kritik. Handke sprach damals mindestens so sehr als Literaturkritiker wie als Schriftsteller. In dieser Doppelrolle fordert er die Emanzipation der Kritik von den Automatismen der Kritik. Und es dürfte nicht nur für Handke-Verehrer wichtig sein, dass sich aus dieser Doppelrolle erst langsam der Autor mit seiner Beschreibungspotenz entpuppt. Was man im Gang von einer "Bücherecke" zur anderen erlebt, ist die Geburt des Autors Peter Handke aus der Kritik. Und noch eines lässt sich hier ablesen: Jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit ist Handke Literaturkritiker geblieben. Welche anderen Sätze bei der Beschreibung von Literatur möglich sind, zeigt sich anhand des einzigen unveröffentlichten Textes im Band: Handke geht in dieser Rezension aufs Neue mit größter Feinsinnigkeit drei Texten von Dag Solstad, Dragan Aleksic und Xaver Bayer bis ins feinste Knistern der Sprache nach. Wer das liest, will sofort zum Buchhändler eilen.
CHRISTIAN METZ
Peter Handke: "Tage und Werke. Begleitschreiben".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 287 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH