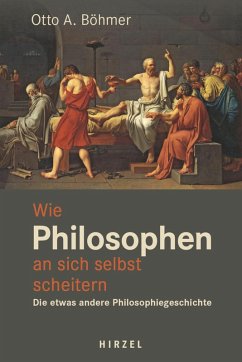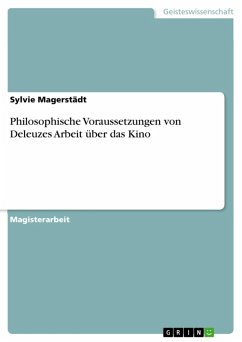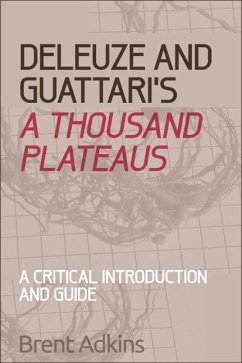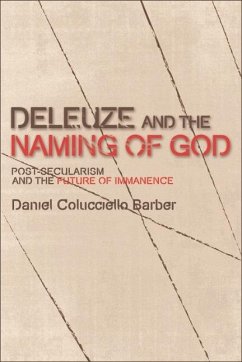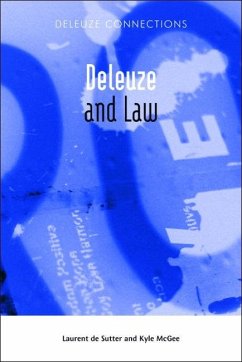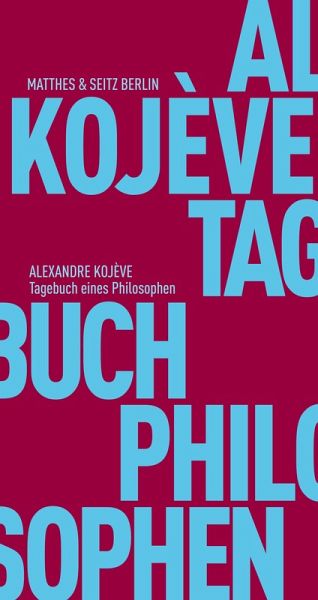
Tagebuch eines Philosophen (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 15,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Er nannte sich selbst "Sonntagsphilosoph", schuf eine epochale Hegel-Interpretation, die auf das Werk von Bataille, Breton, Lacan und Derrida ausstrahlte, spionierte wahrscheinlich für den KGB und war Co-Architekt des europäischen Wirtschaftsraums: Kaum ein Denker des 20. Jahrhunderts griff so lustvoll und verschiedentlich in die Geschichte ein wie Alexandre Kojève. Dass schon dem achtzehnjährigen Kojève ein anderes Leben als pure Zumutung erschienen wäre, zeigt sein "Tagebuch eines Philosophen", das Erinnerungen, Reflexionen und Gedichte des gerade nach Westeuropa aufgebrochenen Student...
Er nannte sich selbst "Sonntagsphilosoph", schuf eine epochale Hegel-Interpretation, die auf das Werk von Bataille, Breton, Lacan und Derrida ausstrahlte, spionierte wahrscheinlich für den KGB und war Co-Architekt des europäischen Wirtschaftsraums: Kaum ein Denker des 20. Jahrhunderts griff so lustvoll und verschiedentlich in die Geschichte ein wie Alexandre Kojève. Dass schon dem achtzehnjährigen Kojève ein anderes Leben als pure Zumutung erschienen wäre, zeigt sein "Tagebuch eines Philosophen", das Erinnerungen, Reflexionen und Gedichte des gerade nach Westeuropa aufgebrochenen Studenten versammelt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.