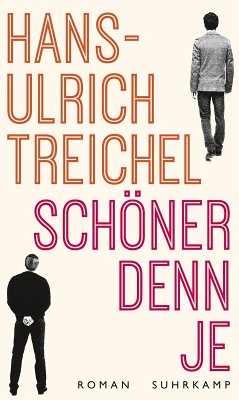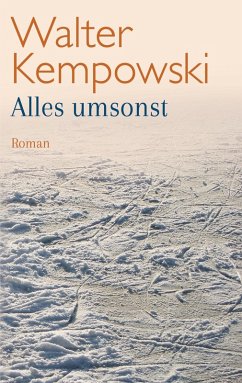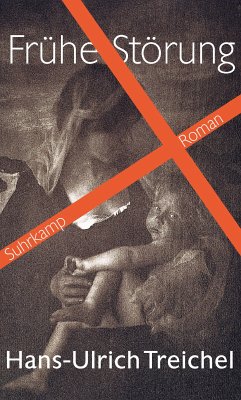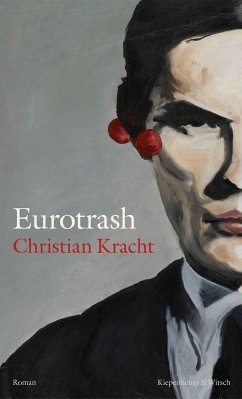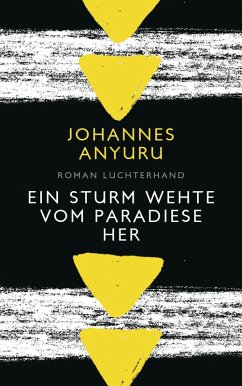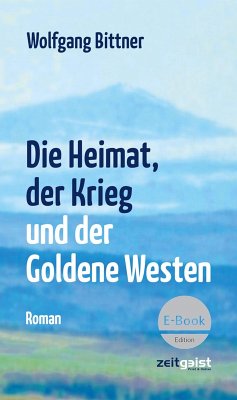Tagesanbruch (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine Mutter hält ihren erwachsenen Sohn in den Armen. Er ist tot, wie sich bald herausstellt; sie hat ihn während der letzten Monate seiner Erkrankung gepflegt. Bevor die alte Frau den Arzt ruft, beginnt sie mit dem Sohn ein letztes Gespräch, einen Monolog, der zur Bilanz und zur Erinnerung wird: an ein Leben an der Seite eines kriegsversehrten Mannes, an das gemeinsam geführte Textilgeschäft im Nachkriegsdeutschland, an das Glück, ein Klavier anzuschaffen, »etwas von Dauer«, schwarzglänzend und für den einzigen Sohn, den sie liebte und der doch immer ein Fremder für sie geblieben i...
Eine Mutter hält ihren erwachsenen Sohn in den Armen. Er ist tot, wie sich bald herausstellt; sie hat ihn während der letzten Monate seiner Erkrankung gepflegt. Bevor die alte Frau den Arzt ruft, beginnt sie mit dem Sohn ein letztes Gespräch, einen Monolog, der zur Bilanz und zur Erinnerung wird: an ein Leben an der Seite eines kriegsversehrten Mannes, an das gemeinsam geführte Textilgeschäft im Nachkriegsdeutschland, an das Glück, ein Klavier anzuschaffen, »etwas von Dauer«, schwarzglänzend und für den einzigen Sohn, den sie liebte und der doch immer ein Fremder für sie geblieben ist. Denn seine Existenz verdankt sich womöglich einer traumatischen Gewalterfahrung, die sie zeitlebens bedrängt hat. »Tagesanbruch« führt ins Zentrum von Hans-Ulrich Treichels Schreiben, ganz nah heran an die Schmerzpunkte von Verlust und Verlorenheit. Es ist die eindringliche, tieftraurige Erzählung einer Frau, die am Totenbett ihres Kindes endlich all das auszusprechen versucht, was sie niemals ausgesprochen hat; und am Ende doch bekennen muss, dass ihr die Worte versagen. Denn »es gibt Dinge, die verschweigt man sogar den Toten«.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.




heikesteinweg_sv.jpg)