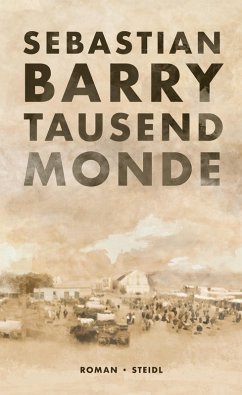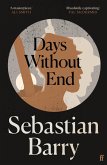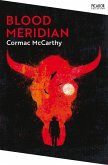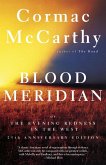Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Sebastian Barry setzt die Diaspora-Saga fort
Was für ein erschütterndes Bekenntnis: "Ich komme aus der traurigsten Geschichte, die es auf Erden je gegeben hat. Ich bin eine der Letzten, die noch weiß, was mir genommen wurde. Das Gewicht der Trauer hat so manchen Kopf zermalmt." So spricht Winona, ein Waisenkind vom Stamme der Lakota. In Paris, Tennessee, um 1870 haben die Verheerungen des Bürgerkriegs das Land weithin verwüstet. Die Lage ist unübersichtlich, die Stimmung gereizt, die Zukunft düster. Marodierende Rebellengruppen der geschlagenen Konföderierten machen die Gegend unsicher, immer wieder flackern Kampfhandlungen auf. Auf einer alten Tabakfarm jedoch hat sich McNulty ein Refugium geschaffen: Mit seinem Liebhaber John Cole, den er aus gemeinsamen Soldatentagen kennt, zwei vormaligen Sklaven sowie dem Indianermädchen, das er aufgenommen hat und väterlich betreut, bildet er eine Art Patchworkfamilie und will den schlimmen Zeiten trotzen. Doch die Idylle bleibt brüchig: Winona weiß, dass ihr Wohltäter am Feldzug gegen ihre eigene Familie beteiligt war. Seine Fürsorge folgt einem Massaker.
Lesen und Schreiben hat Winona gelernt, sie arbeitet bei einem Anwalt und wagt sich immer weiter in die Welt der Weißen. Da gerät sie in einen Strudel sich überstürzender Ereignisse. Sie wird misshandelt, vergewaltigt und in militärische Aktionen verstrickt. Als junger Mann verkleidet, nimmt sie an einem Rachezug teil, erleidet eine Schusswunde und verliebt sich in eine schöne und verwegene Kämpferin namens Peg, die auf der gegnerischen Seite steht. Die unbedingte Liebe dieser beiden jungen Frauen zueinander bildet das Hoffnungszentrum ihrer ansonsten ruhelosen Leidensgeschichte.
Mit diesem Roman, seinem achten, nimmt sich der irische Erfolgsautor Sebastian Barry, Jahrgang 1955, sehr viel vor. Immer schon ist er darauf bedacht gewesen, düstere Vergangenheiten zu erkunden und historische Geschichten zu erfinden, um sich auf diesem Weg den Abgründen der Gegenwart zu stellen. Seine bisherigen Romane lassen sich allesamt als Netzwerk lesen, das die Geschicke einer weitverzweigten Familie, der McNultys, in der irischen Diaspora verbindet. Im preisgekrönten Vorgängerroman "Tage ohne Ende" (deutsch 2018) erzählte uns Tom McNulty, ein junger Desperado, wie er dem Großen Hunger in Irland entflieht, in Amerika in die Armee der Unionisten eintritt, sich in allerhand Bluttaten verstrickt und doch seine Zuversicht erhält. In der Liebe zu John Cole gelangte er durch sämtliche Höhen und Tiefen und gründete mit ihm schließlich eine leidlich glückliche Ersatzfamilie.
"Tausend Monde" setzt diese Geschichte fort, verschiebt jedoch die Sicht. Jetzt wird die vormalige Randfigur Winona zur Erzählerin und soll ihre eigene Perspektive geltend machen. Das aber gelingt nicht überzeugend. Man braucht kein Anhänger des allfälligen Authentizitätswahns in der Literatur zu sein - in englischen Rezensionen wurde diskutiert, ob ein weißer älterer heterosexueller Mann eine junge lesbische Sioux-Frau zum Sprechen bringen darf -, um festzustellen, dass ein derart routinierter Autor gerade dabei strauchelt. Er bürdet seiner Kunstfigur zu viel auf einmal auf und lässt ihr zu wenig Raum, sich zu entfalten. Die vielen dramatischen Wendungen wirken eher wie Einfälle des Autors als wie Schicksalsschläge, der Plot findet keinen Rhythmus und seine Erzählerin keine glaubwürdige Stimme. Sätze wie "In der großen und endlosen Blumenkette menschlicher Verletzungen mochte die einer Einzelnen von geringer Bedeutung sein" oder "Im Gebrodel dieses Augenblicks wurden Ungeduld und Schläfrigkeit eins" sind entweder Stilblüten oder peinliche Indianersprache. Und Liebesschwärmereien wie "Könnte man Honig in der Luft schweben lassen, dann wäre das Peg. Könnte man einen Abschnitt des wildesten Flusses nehmen und ihn in einen Menschen verwandeln, dann wäre das Peg. Könnte man seine Lippen auf einen pulsierenden Stern drücken, dann wäre das Peg" sind bloßer Kitsch.
Man darf durchaus gespannt sein, ob Barry seine McNulty-Saga fortsetzt und welchen Erschütterungen er künftig folgt. Im aktuellen Roman aber scheint es, als habe das Gewicht der Trauer, die darin zur Bearbeitung gelangen soll, die gutgemeinte literarische Idee zermalmt.
TOBIAS DÖRING
Sebastian Barry:
"Tausend Monde".
Roman.
Aus dem Englischen von Hans-Christian
Oeser. Steidl Verlag, Göttingen 2020. 256 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main