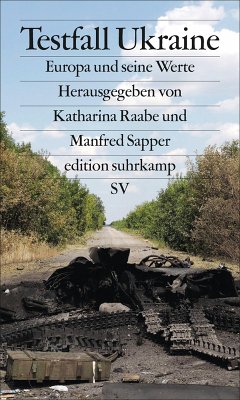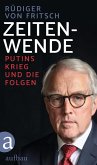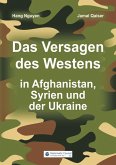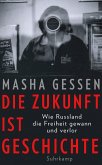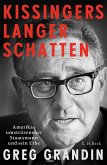Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Donbass als Testfall: Historiker und Publizisten suchen Antworten auf die Katastrophe im Zentrum Europas
"Der Krieg breitet sich aus wie Nebel, er zerstört den Horizont, wirkt auf das Sichtfeld", schreibt die Fotografin und Autorin Yevgenia Belorusets zu ihrem Fotoessay über den ukrainischen Donbass. Der Krieg wirkt aber längst nicht nur auf das Sichtfeld der unmittelbar Betroffenen, sondern verändert alles. Gleichgültig ist dabei, ob man das wahrhaben will oder beharrlich glaubt, es ignorieren zu können.
Ein hybrider Krieg wie der in der Ostukraine stellt die europäische Nachkriegsordnung in Frage. Und er wird, weil er kein eigentliches Ende kennt, zum "ständigen Begleiter des Friedens" (Herfried Münkler). Anders als im ersten Essay-Band zur neuen Ukraine ("Euromaidan", Suhrkamp 2014) versammeln die Herausgeber Katharina Raabe und Manfred Sapper in "Testfall Ukraine" Historiker wie Karl Schlögel, Herfried Münkler oder Andreas Kappeler und Künstler, russische und ukrainische. Sie analysieren aus sehr unterschiedlicher Perspektive nicht nur die Ereignisse an der Peripherie Europas, sondern versuchen auch, ihre Folgen abzuschätzen. Für die Ukraine genauso wie für Russland und für Europa insgesamt.
Der britische Osteuropa-Historiker Andrew Wilson (University College London) fasst, ausgehend von der Vorgeschichte der sogenannten Donbass-Eliten - eine besonders habgierige, skrupellose postsowjetische Gemeinschaft - die Geschichtsdebatten zusammen, die dem Krieg aus russischer Sicht seine scheinbare Legitimität verleihen sollen. Zwischen Geschichtsmythen von den Saporischja Kosaken und Neurussland-Phantasien, die nicht zum ersten Mal aufbranden, macht er den Zündfunken für die Eskalation aus, mit der wir heute konfrontiert sind. Er stellt den einander widersprechenden Versionen aus Russland und der Ukraine die Dekonstruktion der Mythen gegenüber, ergänzt sie mit einer kühlen, faktengesättigten Wirtschaftlichkeitsanalyse zum Donbass. Dessen ökonomische Bedeutung werde, aus propagandistischen Gründen, stark überschätzt. Weil all diese Ansprüche nicht miteinander vereinbar sind, werden sie, so Wilson, die Atmosphäre auf Jahre noch vergiften.
Die Moskauerin Irina Prochorova, Literaturkritikerin mit eigenem Verlag, ist eine Stimme des anderen Russland. Sie spricht für die Demokraten, die man heute als Aufwiegler und Wüstlinge denunziert, als "Voltairianer", was - zumindest aus europäischer Perspektive - fast hoffnungsvoll klingt. Klug und mutig holt auch sie das Unbewältigte, Unausgesprochene hervor, das die Geschichte der russländischen Gesellschaft von jeher geprägt hat, ihr imperiales Selbstverständnis, das der Idee des Territoriums den Vorrang einräumt bis heute, gegen die "Idee des Volkes, das dort lebt".
Prochorova beschreibt die Depression, in die Russlands Aggression seine Demokraten stürzte, die Gewalt und die Willkür, die so viele in die Emigration zwingt. Sie konstatiert Enttäuschung über alles, was in der postsowjetischen Zeit an Freiheiten und Zivilität errungen und heute wieder verloren ist - und verweigert doch die Kapitulation. Diese Jahre hätten auch bewiesen, "dass die russländische Gesellschaft kreativ und flexibel auf Modernisierungsanforderungen reagieren kann". Ein "autoritärer Virus", der die neue Kreml-Rhetorik und ihre schockierenden Propagandaerfolge hervorgebracht habe, bedrohe Europa als Ganzes.
Der sanfte Lyriker und Romancier Serhij Zhadan aus Charkiw fährt an die Front, gemeinsam mit den Volontären, einer unglaublichen neuen Zivilbewegung junger Ukrainer. Sie tun das, wozu weder die kaputte reguläre Armee noch der schwerfällige, im Umbruch befindliche Staat in der Lage sind: Mit einem uralten VW-Bus bringen sie Medikamente, Post, warme Kleidung, Schuhe zu den Soldaten; der Dichter und ein Musiker dürfen nur mit, um den Soldaten etwas vorzulesen, vorzusingen und zu reden. Sie treffen auf "Majdanler" und Leute vom Berkut, die vor kurzem noch Gegner waren. Der Krieg, sagt Zhadan, zerreiße die Ukraine nicht, er schweißt sie zusammen. Zhadan fährt durch seine Heimat, es ist die schläfrige Landschaft seiner Romane. "Das Land lebt nach wie vor in Angst vor sich selbst . . ." Gäben die einen dem "Majdan" alle Schuld an diesem Unglück, würden andere Stimmen immer lauter, die verlangten, "den Donbass gehen zu lassen".
Arkadi Babtschenko, dessen Kriegsreportagen aus Tschetschenien Aufsehen erregten, verzweifelt am moralischen Niedergang seines Landes. Er hält diesen Krieg für einen der schrecklichsten. Zwar hätten andere mehr Opfer gefordert, doch die unheimlichste "Innovation" dieses neuen sei die Anonymisierung der russischen Truppen, bis ins namenlose Grab. Grauenhaft auch, weil viele der Hinterbliebenen damit einverstanden seien, schwiegen für eine Kompensationszahlung. Er stellt diesem tausendfachen anonymen Tod, der in Russland nicht zähle, bewundernd die hundert Majdan-Opfer gegenüber, für die Ukrainer eine "nationale Tragödie". Für Babtschenko hat Putins Aggression das Gute im Menschen getötet, ein Brudervolk entzweit und den Hass gezüchtet: Das sei seine "schrecklichste Tat".
"Testfall Ukraine" ist ein vielstimmiger Appell an die Vernunft, sich dieser Katastrophe zu stellen, die nicht nur Europas Einheit bedroht, sondern vor allem sein Selbstverständnis. Karl Schlögels leidenschaftliche Reflexion über ein verstelltes Wissen, das nicht nur seine Zunft lange geblendet hat, ist hier besonders zu empfehlen. Es gehe darum, so Schlögel, sich klarzuwerden über die "schockierende Abwesenheit der Ukraine im Horizont von Zeitgenossen, die sich durchaus als aufgeschlossen und wach bezeichnen dürfen".
REGINA MÖNCH
Katharina Raabe, Manfred Sapper (Hrsg.): "Testfall Ukraine". Europa und seine Werte.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 250 S., 20 Abb., br.,
15,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main