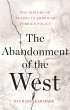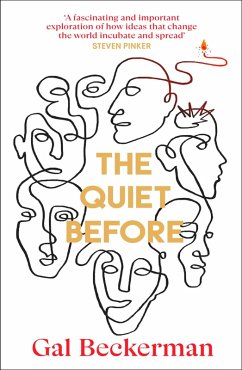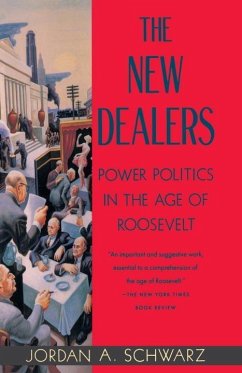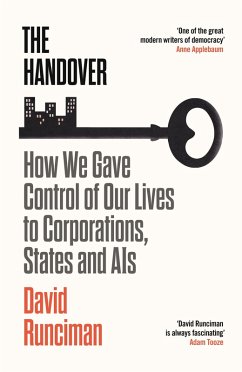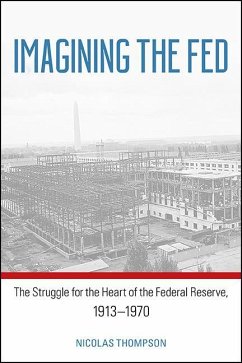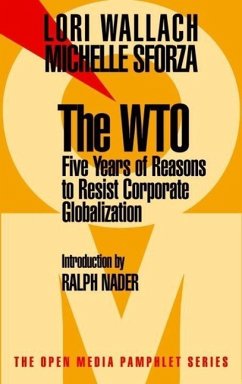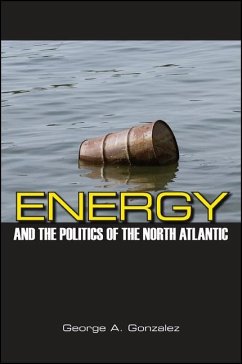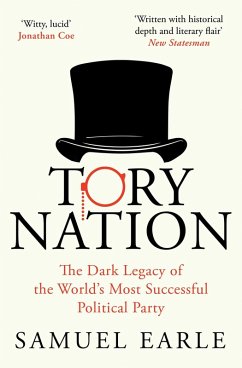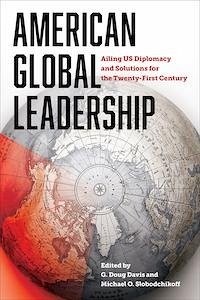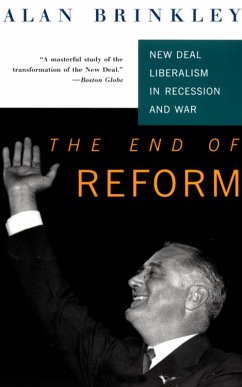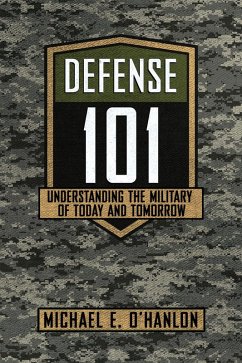The Abandonment of the West (eBook, ePUB)
The History of an Idea in American Foreign Policy
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
14,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
This definitive portrait of American diplomacy reveals how the concept of the West drove twentieth-century foreign policy, how it fell from favor, and why it is worth saving.Throughout the twentieth century, many Americans saw themselves as part of Western civilization, and Western ideals of liberty and self-government guided American diplomacy. But today, other ideas fill this role: on one side, a technocratic "liberal international order," and on the other, the illiberal nationalism of "America First."In The Abandonment of the West, historian Michael Kimmage shows how the West became the dom...
This definitive portrait of American diplomacy reveals how the concept of the West drove twentieth-century foreign policy, how it fell from favor, and why it is worth saving.
Throughout the twentieth century, many Americans saw themselves as part of Western civilization, and Western ideals of liberty and self-government guided American diplomacy. But today, other ideas fill this role: on one side, a technocratic "liberal international order," and on the other, the illiberal nationalism of "America First."
In The Abandonment of the West, historian Michael Kimmage shows how the West became the dominant idea in US foreign policy in the first half of the twentieth century -- and how that consensus has unraveled. We must revive the West, he argues, to counter authoritarian challenges from Russia and China. This is an urgent portrait of modern America's complicated origins, its emergence as a superpower, and the crossroads at which it now stands.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzl. MwSt. | Innerhalb Deutschlands liefern wir preisgebundene Bücher versandkostenfrei. Weitere Informationen: bitte hier klicken
Support
Bitte wähle dein Anliegen aus:
Rechnungen
Bestellstatus
Retourenschein
Storno