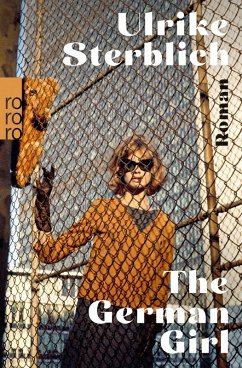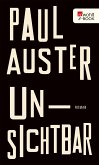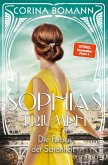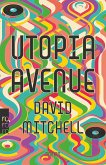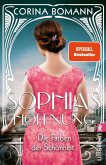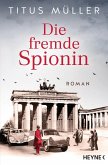Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Ulrike Sterblichs Roman "The German Girl" zeigt die New Yorker High Society auf deutschem Speed.
Die sechziger Jahre waren die Ära des öffentlich zelebrierten Rauschmittelgenusses. So will es jedenfalls die vulgäre Popgeschichtsschreibung. Denn natürlich hat alles seine Vorläufer. Man denke nur an die Opiumhöhlen des neunzehnten Jahrhunderts oder an die Berliner Kokain-Szene, die sich zwischen den Kriegen mit den Restbeständen geschäftstüchtiger Militärärzte eindeckte. Klaus Mann schrieb begeistert: "Früher mal hatten wir eine Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten! Laster noch und noch! Kolossale Auswahl! Das muss man gesehen haben!"
Zwischen den Roaring Twenties und den psychedelischen Sixties liegt allerdings eine dunkle Epoche, in der deutsche Soldaten mit dem 1937 patentierten Wirkstoff Methamphetamin in den Blitzkrieg geschickt worden waren. Das Präparat Pervitin, das körperliche und emotionale Erschöpfung unterdrückt, ging als "Hermann-Göring-Pille" in die Medizingeschichte ein. Ulrike Sterblich hat mit "The German Girl" einen Roman über die Nachkriegs-Karriere dieser deutschen Droge geschrieben. Er spielt in der ausgerechnet von Berliner Emigranten-Ärzten gepäppelten Crème von New York City.
Sterblich hangelt sich in ihrem Milieuroman erfreulicherweise nicht am Mythos von Warhols Factory entlang. Stattdessen arbeitet sie die allgemeine Aufgeschlossenheit gegenüber Stimmungsaufhellern auch in jenen Bevölkerungsteilen heraus, die den Vorwurf des Drogenmissbrauchs schockiert von sich gewiesen hätten. Unter dem Schirm der modernen Medizin konnte auch die Hausfrau aus dem Mittleren Westen einen Ausweg aus der Enge ihrer Lebensumstände finden. Das kann man nach wie vor sehr gut in Jonathan Franzens Epochenroman "Die Korrekturen" nachlesen. Allerlei Präparate, die in einer heutigen Hausapotheke undenkbar wären, wurden über den Gartenzaun hinweg gereicht und machten das Vorstadtleben etwas schriller. So ist es nicht verwunderlich, dass Mona, die Hauptfigur aus "The German Girl", ihre langen Beine der Werbekampagne einer Diätpillen-Firma leiht.
Die junge Deutsche ist aus Berlin in die Stadt der Sternchen gekommen, um dort als Model zu reüssieren. Wir verfolgen ihre neugierigen Erkundungen durch Manhattan, und durch ihre Augen entsteht ein Bild des New Yorker Undergrounds. Auf einer exzentrischen Künstlerparty werden den Gästen ihre Wintermäntel zerschnitten, in einem Verschlag der Wohnung hockt ein Guru und nimmt dem verstrahlten Partyvolk die Beichte ab. Mona macht alles in allem eine gute Figur in dieser Szenerie aus Irren, Genies und irren Genies. Über einen verlotterten Szenegänger heißt es cool: "Matsch klebte ihm an Kleidung und Haaren, seine Schuhe sahen aus wie von einem geistesgestörten Schuster zusammengenähtes Herbstlaub." Alles irgendwie abstoßend und anziehend zugleich. Mona lässt sich treiben aus Neugier, aus Lebenshunger, manchmal auch aus Unentschlossenheit.
Bei einem Rundgang durch die Alten Meister im Metropolitan Museum lernt sie den jungen Ostküsten-Aristokraten Sidney kennen, der sich sofort in Monas minimalistischen Swing verliebt. Und der den gesamten Roman über dranbleiben wird an seiner Traumfrau. Mona wiederum fühlt sich verunsichert von Sidneys ernsten Absichten. Sie stürzt sich deswegen in diverse Abenteuer mit diversen Herren. Der arme Sidney! Aber wie gesagt: Er bleibt am Ball. Und weil dieser Roman nicht die Geschichte einer tragischen Selbstzerstörung entfaltet, sondern die einer persönlichen Reifung, breitet sich in der Leserin ein Gefühl von tiefer Sympathie für diese lässige Heldin aus.
Die eigentliche Geschichte, die "The German Girl" erzählt, ist aber durchaus abgründig. Sie beruht auf dem erwähnten Umstand, dass es ausgerechnet aus Deutschland geflohene Ärzte waren, die New York in den ersten Nachkriegsjahrzehnten mit Amphetaminen versorgten. Auf Rezept. Mit gekonnter Injektion in den Po oder auch to go.
Der berühmteste dieser von Aretha Franklin als "Dr. Feelgood" besungenen Ärzte war Max Jacobson. Er hatte es zu beachtlicher Popularität gebracht mit einer Remedur aus Vitaminen, Hormonen, Enzymen und Plazenta: alles zusammengemixt in einem schmuddeligen Hinterzimmerlabor, das Jacobson großspurig als "Constructive Research Foundation" bezeichnete. Dass seinen Aufbauspritzen immer auch eine ordentliche Portion Speed beigegeben war, galt in der Szene als offenes Geheimnis. Robert Freymann, dessen ähnlich spezialisierte Praxis sich in unmittelbarer Nähe zu Jacobsons befand, war der Ansicht: "Besser sie kommen zu mir, als sich mit Drogen, Alkohol und ungesunder Lebensweise zugrunde zu richten." Wer einen Hangover hatte, bekam vom Doktor einen "Fallschirm" verschrieben.
Irritiert blickt man mit diesem fein ironischen Roman zurück in eine Epoche, als das Vertrauen in die hippokratischen Tugenden väterlicher Ärztedarsteller noch grenzenlos schien. Selbsttäuschung ist ja bekanntlich die bitterste Art der Täuschung. Erst als sich psychotische Abstürze häufen und es zu einem Todesfall kommt, der die Gerichtsmedizin auf den Plan ruft, beginnt der Mythos von "Miracle Max" zu bröckeln. Auch Mona ist inzwischen Stammgast in seinem Behandlungszimmer. Anders als der grippekranke Sidney, der schnell abgefertigt wird: "Sie hatte vergessen, wie ungern es in der Praxis von Dr. Max Jacobson gesehen wurde, wenn man dort mit einem echten Infekt erschien."
Jacobsons berühmtester Klient soll John F. Kennedy gewesen sein. Zusammen mit den anderen Patienten hätte er im Miracle-Max-Wartezimmer ein Klassentreffen der hundert prominentesten Amerikaner veranstalten können: Yul Brynner, Anthony Quinn, Tennessee Williams, Eddie Fisher, Elizabeth Taylor, Maria Callas, Hedy Lamarr, um nur einige zu nennen. Und natürlich Truman Capote, der den Doktor als "gewaltige theatralische Figur" und später noch viel besser als "das deutsche Insekt mit dem magischen Stachel" beschrieben hatte.
Grundlage des Romans sind zwei Enthüllungsgeschichten aus den frühen Siebzigern, im "New York Magazine" und der "New York Times", die den sich häufenden Vorwürfen gegen die Doctor Strangeloves von der Upper East Side nachgegangen waren. Achtzig Milligramm Methamphetamin soll allein Jacobson monatlich für seine Patienten bestellt haben. Das entsprach etwa hundert starken Dosen Speed. Ein starker Stoff also im Wortsinn, den Ulrike Sterblich hier bewundernswert unpompös, um nicht zu sagen lässig, aufführt und der nach seiner Verfilmung schreit.
KATHARINA TEUTSCH
Ulrike Sterblich:
"The German Girl". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2021. 384 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
© Perlentaucher Medien GmbH