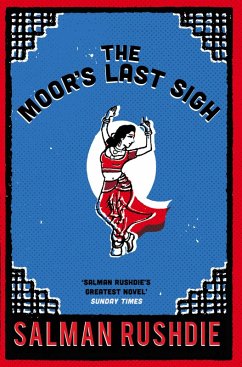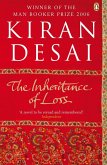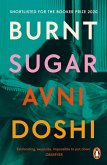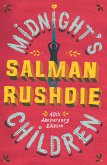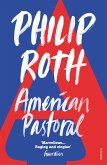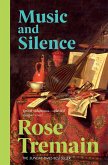Moraes 'Moor' Zogoiby is the last in line of a crooked and fantastical dynasty of spice merchants and crime lords from Cochin. He is also a compulsive storyteller and an exile. As we travel with him on a route that takes him from India to Spain, he spins his labyrinthine family tale of mad passions and volcanic family hatreds.
But does the India of his parents - populated by extravagant artists, piratical gatekeepers and mysterious lost paintings - still exist? And will he ever discover what became of his fiery and tempestuous mother? Moraes' epic quest to uncover the truth of the past is a love story to a vanishing world, and also its last hurrah.
**One of the BBC's 100 Novels That Shaped Our World**
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Salman Rushdies Roman "Des Mauren letzter Seufzer" / Von Walter Klier
Es ist alles da, was in einen Roman von Salman Rushdie gehört: die so furios wie manieristisch vorgetragene Geschichte voller Neben-, Vor- und Hintergedanken, die Hitze und "das große Gewimmel des Lebens selbst", eine Welt heftiger Leidenschaften und greller Farben, der Schönsten und der Häßlichsten, wie sie nur noch in Lateinamerika oder eben Indien vorkommen kann; dann die Metropole Bombay; dann ein verunstalteter Ich-Erzähler und Held (er hat statt der rechten Hand eine Art Klaue und altert doppelt so schnell wie normale Menschen), das dynastisch-unübersichtliche Familiendrama, die Alten, an deren Starrsinn jede noch so starre Konvention zuschanden wird, die drei Schwestern und ihre wechselnden Ehegeschicke, verflochtene Zeit- und Familiengeschichte, die blumigen Verwünschungen, die Prophezeiungen, die großen Sprüche, die Dekadenz, die mit dem Abfall vom Glauben der Väter einhergeht, schier unglaubliche Schurkereien und kuriose Namen, Figuren, die nur erfunden scheinen, auf daß ihr Erfinder sich flugs über sie lustig machen kann, die immense Belesenheit des Autors, seine wohldosierten Bildungshäppchen, Anspielungen, Motive aus der Literatur wie kleine, solide Leuchttürme auf dem weiten Erzählmeer, und natürlich das wiederkehrende Motiv "Indien und der Westen", ein Konflikt voll ödipalem Ablösungsschmerz, in dem das alte Indien sich gegen das junge (und schon wieder hinter dem Horizont verschwindende) England auflehnt.
"Der Pfeffer war es, der Vasco da Gamas Dickschiffe veranlaßte, über die Meere zu segeln, von Lissabons Leuchtturm Torre de Belém bis zur Küste von Malabar, anfangs nach Calicut und später, wegen des Lagunenhafens, nach Cochin. Im Kielwasser jener portugiesischen Erstankömmlinge segelten Engländer und Franzosen, so daß wir zur Zeit der Entdeckung Indiens - aber wie konnten wir entdeckt werden, da wir doch zuvor niemals bedeckt gewesen waren? - ,weniger ein sub-continent als ein sub-condiment (Zutat, Würze) waren', wie meine vornehme Mutter es formulierte: ,Von Anfang an war es kristallklar, was die Welt von der verdammten Mutter Indien wollte', pflegte sie zu sagen. ,Scharfe Sachen wollten sie, genau wie ein Mann, der zu einer Hure geht.'"
Insbesondere von der indischen Literatur will die (Erste) Welt ebendies und nichts anderes, und so wird auf der vierten Umschlagseite auch "pfeffrige Liebe" annonciert. Das bringt, wie wir seit García Márquez wissen, nicht nur eine im Einzelfall jeden europäischen Maßstab sprengende Sinnenlust, sondern vor allem die Liebe in ihrer uralten, eigentlichen und leider von unserer Moderne aus der hohen Kunst verbannten Form mit sich: "Die junge Erbin beugte sich zu ihm herab, nahm sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger, fixierte ihn mit ihrem grimmigsten Blick und verliebte sich bis über beide Ohren in ihn."
So soll es auch sein. Bei all dem bedarf es eines naiven Glaubens an den eigenen Zauber, an das Funktionieren der eigenen Überredungskunst, und die, so will dem Rezensenten scheinen, ist dem großartigen Erzähler Salman Rushdie diesmal völlig abhanden gekommen.
Rushdies Held und Ich-Erzähler, Moraes Zogoiby, genannt Moor, Frucht der erwähnten Über-beide-Ohren-Liebe, erzählt uns die Geschichte seiner Familie und sein eigenes kurz-langes sechsunddreißigjähriges Leben, an dessen Ende er angelangt ist, so kunterbunt und wortreich, wie man es von einem Erzähler nun lieber doch nicht hätte. Er hält mit nichts, aber auch gar nichts hinter dem Berg; und verliert dabei unterwegs dauernd den Faden. Ganze Kompanien seines in Schwärmen auftretenden Personals werden mit einer Nonchalance aufgetragen und abserviert, daß einem schwindlig werden könnte, wenn einem nicht schon so langweilig wäre.
Je weiter der Rezensent in seiner Lektüre voranschritt, desto weniger war er gewillt, den Erzähler "Moor" um der literaturkritischen Konvention willen noch von dessen Erfinder abzutrennen - wer anders spricht hier auf diesen Seiten, wenn nicht der uns seit seinen politischen Mißhelligkeiten wohlbekannte Weise aus dem Morgenland mit dem hängenden Augenlid und dem hintergründigen oder zumindest zweideutigen Lächeln, dem es vor einigen Jahren gelang, eine Weltreligion (oder immerhin einen bedeutenden Teil davon) gegen sich aufzubringen, und der nun anscheinend dasselbe Kunststück ein zweites Mal versucht, diesmal mit dem Hinduismus. Als Minimalvariante für weltweite Ehrenbeleidigung hat er einen Schlüsselroman über die Korruption in seinem geliebten Bombay ("meine verlorene Stadt!") eingebaut und so sichergestellt, daß es der herrschenden Clique dortselbst "wie Schuppen von den Augen fällt" und sie mit den iranischen Mullahs in Konkurrenz treten kann.
Den Rezensenten hat die Lieb- und Leblosigkeit verstört, mit der Meister Rushdie seine Pfefferspeise komponiert, und als er, um seine Zweifel loszuwerden, sich zwei der schönen früheren Romane vornahm, ward er seltsam berührt von einer Episode aus "Mitternachtskinder". Dort muß ein islamischer Poet sich vor seinen Verfolgern in Sicherheit bringen - und es wird ihm klar, "that you cannot write poetry underground". So als wollte Rushdie dies an sich selber exemplifizieren, hat er weniger einen Roman verfertigt als vielmehr eine Art Attrappe, eine fast perfekte Nachahmung des "real thing", dessen Teile mit dem Fortschreiten der Lektüre sich immer weniger zu einem Ganzen fügen, zu dem gelungenen Golem, der sich zu recken und zu strecken beginnt und zumindest für die Dauer der Lektüre Angst macht, rührt und zum Lachen bringt.
Merkwürdigerweise müssen in diesem Roman die Figuren immer wieder furchtbar lachen; bloß der Leser nicht. "Meine Schwester Mynah, die Stimmen-Imitatorin . . . löste im Familienkreis Lachkrämpfe aus, wenn sie meine gebremsten Manieren in schlafwandlerischem Zeitlupentempo nachahmte; doch dieser ,Slomo' - ihr Spitzname für mich - war lediglich eine meiner geheimen Identitäten, nur die sichtbarste meiner vielen Schichten der Tarnung."
Als Vermutung sei hierhergesetzt, daß dem Autor, wo er sich an den oberen Zehntausend und der Hochfinanz versucht, die Expertise abgeht, während er früher, bei der Schilderung der strebenden, zwischen Tradition und unausweichlicher Moderne zerrissenen Mittelschicht, ganz bei sich und seiner Erfahrung und damit überzeugend war. Wie der verruchte Abraham Zogoiby tatsächlich seine Geschäfte macht, wird in "Des Mauren letzter Seufzer" nicht plausibel. "Waffen spielten bei dem ganzen eine große Rolle, obwohl der Handel mit ihnen auf der offiziellen Liste der Aktivitäten dieses großen Konzerns nicht auftauchte." Doch nicht nur die Schilderung der verwickelten Firmengeschichte der Da-Gama-Zogoiby-C-50-Corporation klingt manchmal, als hätte sich ein sehr belesener Europäer aufgemacht, sich und uns eine Vorstellung vom bunten Indien zu geben.
Die Übersetzerin Gisela Stege hat das Ihre dazu beigetragen, daß kein noch so heftiger Stromstoß diesen Frankenstein-Lehmkloß lebendig zu machen vermag. Aus Rushdies ohne Zweifel schwierigem, mit Metaphern und Kalauern und Wortbildungsfeuerwerken aufgeladenem Hochgeschwindigkeits-Anglo-Indisch ist ein breitbeinig holperndes Indo-Germanisch geworden, so als habe die Sinn-Überfüllung des Originals zu einer Übersetzer-Enthemmung geführt. An vielen Stellen scheint das Englisch so durch den deutschen Text, als sehe man die Mundbewegungen des Schauspielers, während man unfreiwillig die Untertitel mitliest. ",Hazaré ist also eine entfesselte Kanone', sagte mein Vater." Dieser Hazaré dürfte eine loose cannon, also unberechenbar, sein. Eine Schauspielerkarriere "entpuppte sich als totgeborenes Kind", und sein (jüdischer) Vater bietet Moor eine "Einwegfahrkarte" nach Jerusalem an. Die anglo-indischen Marotten, die Rushdie seinen Figuren mit liebevoller Insistenz in den Mund legt, als da sind Suffixe (Mummyji), Wortverhunzungen ("nach Curry richofiziert", "kümmerifiziere du dich ums Geschäft!"), Echowörter (Schwengel-Stengel), allgemeine Wortballungen lassen die deutsche Version so verlangsamt wirken wie die Dostojewskis unserer Lese-Jugend mit ihren vielen Pud, Werst und Onkelchens.
Der Moor des englischen Titels, dessen letzter Seufzer hier verhandelt wird, kann natürlich auch ein "Maure" sein (seine semi-mythologischen Vorfahren haben 1492 Spanien verlassen), aber zunächst und hauptsächlich ist er ohne Zweifel ein "Mohr". Der General-Mohr der englischen Literatur huscht denn auch per Anspielung vorbei: ",Wer hat die Synagoge von Cranganore zerstört? Mohren, wer sonst? Hausgemachte, in Indien produzierte Othello-Rowdies!'" Den leicht dissonanten Klang, den der "Mohr" wie der "Moor" in politisch korrekten Ohren hat, dürfte Rushdie beabsichtigt haben; beim Versuch, die indo-germanische Version davon zu säubern, zersplittert der Name in mindestens drei Versionen: Moor, Maure und Mohr.
Das ist nicht schlimm, nur ein wenig lachhaft. Schlimmer ist da schon, daß der Erzähler Salman-Moor so genau und so ausführlich hinschreiben muß, was für einen Roman wir hier lesen, was er damit bezweckt und was wir davon halten sollen (und wann wir lachen und wann wir weinen sollen).
So lesen wir unter anderem einen Künstlerroman, jenen von Moors Mutter Aurora, der größten Malerin des modernen Indien, deren Bilder, ausführlich beschrieben, wiederum eine Art rückbezüglicher Roman-im-Roman sein sollen, und deren Hauptwerk, wie möchte es anders sein, so heißt wie das Buch, das wir gerade lesen, das wiederum Moor am Ende seines Lebens unter Todesdrohung aufgeschrieben hat und das er (hier schließt sich der Bogen vom Anfang her), zuletzt durch eines der allzuvielen Wunder noch davongekommen, mit "Zwei-Zoll-Nägeln" an die Zäune, Bäume, Pfosten Spaniens nagelt wie ebenso viele Wittenberger Thesenblätter (auch diese Assoziation wird ausführlich vermittelt) - eine imaginäre Schnitzeljagd, auf die der Leser da geschickt wird.
Welcher Kritiker hier nicht begreift, daß er angewiesen wird, den Roman als "postmodernen" zu lesen, dem ist nicht zu helfen. Der Autor hilft ihm trotzdem. Kaum einmal vergehen ein paar Seiten, ohne daß man wie ein unwilliger Schüler mit der Nase draufgestoßen würde. Wir befinden uns mit unserem Helden in der reinen Welt des Papiers und der Sprache. ",Was war das für ein Gebäude? Wer waren diese Leute? Waren sie wirklich Polizeibeamte, und wurde ich tatsächlich des Drogenhandels beschuldigt und nun auch noch des Mordes verdächtigt? Oder war ich zufällig von einer Seite, von einem Buch des Lebens in ein anderes geraten . . .'" - so sinniert Moor, als er überraschend verhaftet worden ist.
Ohne es zu wollen, exerziert Rushdie in großem Stil vor, daß eben nicht gleichgültig ist, wer man ist und worüber man schreibt. Es ist nicht gleichgültig, auf welcher Seite im Buch des Lebens man sich befindet, ob in Bombay oder irgendeiner anderen Stadt. Denn nach Bombay sehnt er sich, mit der innigen Hoffnungslosigkeit des Verbannten, und wenn er von seinem Bombay schreibt, hindert ihn die große Zahl seiner Meinungen, die er über alles und jedes hat, nicht daran, Seiten von melancholischer Schönheit zu schreiben. Rushdies besondere Kunstfertigkeit hat aus "Des Mauren letzter Seufzer" etwas gemacht, das dem vollkommensten denkbaren Roman so ähnlich ist, wie in der Geschichte selbst der leitmotivische Hund des Onkels, der, nach seinem seligen Ende nicht nur ausgestopft, sondern dazu auf Räder montiert, durch das Buch rollt, einem richtigen Hund gleicht.
Salman Rushdie: "Des Mauren letzter Seufzer". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Gisela Stege. Kindler Verlag, München 1996. 583 Seiten, geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main