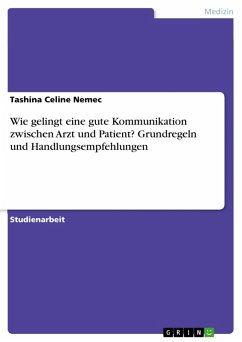Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Zwei Pole sind es, zwischen denen Michael Peintinger die Medizin des angehenden Jahrtausends ausgespannt sieht: der ungeahnte technische Fortschritt und der laute Ruf, die Selbstbestimmung des kranken Menschen zu achten ("Therapeutische Partnerschaft". Aufklärung zwischen Patientenautonomie und Selbstbestimmung. Springer Verlag, Wien und New York 2003. 459 S., br., 39,80 [Euro]). Die Autonomie der Patienten zählt zu den Gründungsmythen der Bioethik. Nicht zufällig trat die Disziplin erstmals im Gefolge der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und den ersten Erfolgen der Intensivmedizin in Erscheinung. Die Proklamation einer Patientencharta stammt aus dem ideellen Fundus der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Wie erlangt man das Himmelreich ärztlicher Integrität? Die Achtung der Autonomie des Patienten, die Pflicht zur Fürsorge und nicht zu schaden, diese drei Prinzipien werden nicht selten für die Lösung ethischer Konflikte propagiert. Das erste unter ihnen aber sei die Beachtung der Patientenautonomie, meint mit einer Reihe vornehmlich amerikanischer Bioethiker auch Peintinger. Seine Darstellung der vielfältigen Konzepte der Autonomie im Kontrast zum Paternalismus der Gesundheitsberufe gehört zu den starken Seiten diese Buchs.
Zwar hat das Paradigma der Patientenautonomie auch Kritiker einer überzogenen Anwendung auf den Plan gerufen, doch sehen die sich stets in die Ecke der Ewiggestrigen gestellt. Ob gewollt oder nicht, der didaktische Kniff von Peintingers Darstellung liegt nun darin, daß er sich verbal auf die Seite der bioethischen Autonomisten schlägt und deren Kritiker kritisiert. Gleichzeitig wird der Autonomiebegriff anthropologisch in einer Weise gedeutet und begrifflich umspannt, daß er schließlich mit den nicht selten hemdsärmeligen Vorstellungen mancher Bioethiker gar nichts mehr gemein hat. Peintinger beruft sich auf den belgischen Medizinethiker Jean-François Malherbe und erweist sich dabei als ein Hermeneutiker im Gewand des Predigers der Autonomie.
Nicht jeder, der von Autonomie spricht, meint das gleiche. Bei Malherbe geht es um weit mehr als um Entscheidungshoheit im Konfliktfall. "Welcher Mensch will der Mensch sein?" zitiert Peintinger den Belgier. Die Frage deutet an, daß man Autonomie nicht ohne Rückgriff auf eine Anthropologie sinnvoll verstehen kann. Und so wird sie in der Folge dann als dialogisches Konzept gedeutet, in dem die "Andersartigkeit und Gleichwertigkeit" der Partner - Patient und Arzt - Anerkennung finden. Der Erhalt und die Wiederherstellung der Autonomie des Kranken werden selbst zum Inhalt der ärztlichen Fürsorge.
Peintinger zeigt, wie das Konzept fruchtbar in den Alltag der Medizin eingebracht werden kann. Dies gelingt im Medium der Sprache. Die Aufklärung des kranken Menschen als wesentliches Merkmal ärztlichen Handelns wird zu einem Akt umfassender Kommunikation, der von Beginn an die Beziehung zwischen Patient und Arzt prägt. Sie ist weit mehr als nur eine juristische Notwendigkeit vor einem medizinischen Eingriff. Sie kommt einer "Interpretation aller Geschehnisse", die den Patienten betreffen, gleich, sie ist selbst ein hermeneutischer Prozeß zwischen Gleichberechtigten. So entwickelt Peintinger sein Leitbild der therapeutischen Partnerschaft. Die Idealität desselben springt in den Zeiten unserer chronisch überlasteten Krankenhäuser deutlich ins Auge.
Auch wenn der Autor gelegentlich vom "neuen Wissen" spricht, sind seine Ausführungen nicht ohne altes Vorbild. Andere haben ähnliches nur anders gesagt. Doch spricht dies nicht gegen das Buch, dessen Darstellung der vielfältigen Verästelungen der therapeutischen Partnerschaft man dankbar zur Kenntnis nimmt. Das gilt etwa für den Umgang mit Wünschen der Patienten, die die moralische Autonomie der Therapeuten kompromittieren könnten. Kein Aspekt bleibt unbeachtet, das schließt auch die Behandlung der aktiven Sterbehilfe ein, die Peintinger im Widerspruch zu der ärztlichen Ethik sieht.
Im Vertrauen auf die Regeln der Diskursethik plädiert Peintinger für eine "Konversion der Aufklärungshoheit", durch welche dem Patienten die Kontrolle über die Beziehung zu den Behandelnden gesichert werden soll. Sosehr der Autor hier am Wesentlichen rührt, so illusionär sind manche seiner diesbezüglichen Vorstellungen. Soll wirklich jeder Mitarbeiter einer Klinik einem Betroffenen en passant das Ergebnis einer Gewebsprobe mitteilen können? Weiß Peintinger nicht, daß selbst der Befund des Pathologen erst nach oftmals komplizierter Interpretation eine Bedeutung erhält? Aus ähnlichen Gründen wird im Blick auf die genetische Diagnostik in der Zukunft zu Recht ein Arztvorbehalt von fast allen Experten für notwendig erachtet.
Aber im Prinzip hat Peintinger schon recht: Der Behandelnde hat es in der Hand, ob der Patient ihm "autonom" gegenübertreten kann oder nicht. Denn erst durch die ärztliche Aufklärung wird der Patient in die Lage versetzt, sinnvolle Fragen zu stellen, Optionen zu erkennen und schließlich selbst entscheiden zu können. Der Patient kann seine Autonomie also nur verwirklichen, wenn der Arzt das situationsgerechte Informieren als Bringschuld begreift, die auch unter hohem Zeitdruck zu leisten ist. Das ist das Heteronome am Konzept Patientenautonomie: Die Autonomie des Patienten beginnt beim Behandelnden.
STEPHAN SAHM
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH