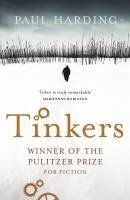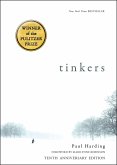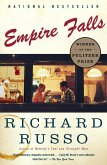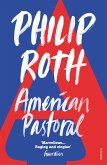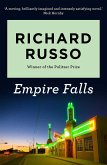A methodical repairer of clocks, he is now finally released from the usual constraints of time and memory to rejoin his father, an epileptic, itinerant peddler, whom he had lost seven decades before. In his return to the wonder and pain of his impoverished childhood in the backwoods of Maine, he recovers a natural world that is at once indifferent to man and inseparable from him, menacing and awe inspiring.
Heartbreaking and life affirming, Tinkers is an elegiac meditation on love, loss, and the fierce beauty of nature.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Der Amerikaner Paul Harding hat für seinem Romanerstling "Tinkers" gleich den Pulitzer-Preis bekommen. Dabei ist das postmodern verschachtelte Resümee eines Sterbenden grandios gescheitert.
Nichts liebt Amerika mehr als eine Erfolgsgeschichte. Wenn in Politik, Wirtschaft, Sport oder Kultur jemand auftaucht, der sich in das Schema "from rags to riches" pressen lässt, was sich im Deutschen übersetzen lässt mit dem Tellerwäscher, der es zum Millionär bringt, läuft die Medienmaschine schon bald hochtourig. Besonders beliebt sind die Unkonventionellen, die doch bloß das Konventionelle des Systems bestätigen. Wer als kleiner Lokalpolitiker effektvoll gegen Washington wettert; wer in seiner Garage technische Revolutionen entfacht; wer aus dem Getto kommt und es zum Basketballstar bringt; wer vom Außenseiter zum Liebling der Kunst-, Theater-, Film- oder Literaturszene avanciert: der revitalisiert den amerikanischen Traum, wird zur periodisch verlangten Projektionsfläche, mutiert zum Identifikationsangebot auf zwei Beinen, dem Lob und Preis sicher sind.
Ein auffälliges Beispiel aus der Literaturszene dieser Tage stellt der 1967 in Wenham, Massachusetts, geborene Schriftsteller Paul Harding dar. Aus einfachen Verhältnissen stammend, studierte er englische Philologie und war Schlagzeuger in einer Rockband, ehe er seinen Master in Creative Writing absolvierte. Seinen Roman "Tinkers" lehnten etliche Verlage ab, woraufhin das Manuskript jahrelang im Dunkel einer Schublade vegetierte. Dann fand sich mit der Bellevue Literary Press ein kleines New Yorker Verlagshaus, das den schmalen Band im Jahr 2009 in einer Auflage von dreieinhalbtausend Exemplaren druckte. Heute rühmen sich zahllose unabhängige Buchhandlungen, ihren Kunden das Debüt gebetsmühlenartig empfohlen zu haben. Vom Leitmedium "New York Times" ignoriert, gelangte Harding auf andere Bestsellerlisten, bis er im Jahr darauf prompt den Pulitzer-Preis erhielt.
Es geht in "Tinkers", der Luchterhand Verlag übernahm den Titel für die deutsche Ausgabe, um einen Ingenieur mit dem symbolträchtigen Namen George Washington Crosby. Der Achtzigjährige bewohnt das fiktive Städtchen Enon in Maine. Von Parkinson und Krebs gezeichnet, lagert der Zeitgenosse auf dem Totenbett und resümiert sein Leben. Paul Harding verzichtet auf kein Charakteristikum postmoderner literarischer Schöpfung, und nach der Lektüre hat man das Gefühl, reine innovationslose Künstlichkeit verdauen zu müssen. Horaz hatte unrecht, als er schrieb, nach der zehnten Wiederholung werde etwas gefallen. Einige angelsächsische Romanciers waren in dieser Hinsicht weiser: darunter Ambrose Bierce, der meinte, einmal sei oft genug, oder Saul Bellow, der überzeugt war, dass Wiederholungen im Orkus verschwänden.
Welche beliebten Elemente also will "Tinkers" unter einen Hut bringen? Da ist die Vater-Sohn-Geschichte - die uns Georges "alten Herrn" Howard, einen der titelgebenden Kesselflicker und fahrenden Händler, näher vorstellt. Da sind Einsprengsel zu Geschichte und Landschaft - in diesem Fall zum amerikanischen Nordwesten, primär Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Da finden wir Details über ein bestimmtes Spezialgebiet - George repariert gern Uhren. Und da wird der Sinn des Daseins, der Tod, die Liebe, die Familie, das Erzählen selbst zum Thema. Doch nirgendwo kreuzt ein origineller Gedanke auf. Das Buch überspielt dies clever: Denn natürlich wechseln die narrativen Perspektiven und zeitlichen Ebenen ständig; natürlich sind Passagen eines (fiktiven) Sachbuchs eingestreut; natürlich richtet sich der Fokus auf den Gang, nicht den Ausgang der Geschichte; und natürlich markieren keine altmodischen Anführungszeichen die wörtlichen Reden.
Die seitens der englischsprachigen Kritik hervorgehobene "Poesie des Textes" erschöpft sich in wenigen Stellen. Eine davon behandelt den kranken Howard in Worten Georges: "Die Welt fiel von meinem Vater ab, wie er von uns abfiel. Wir wurden sein Traum." Es dominieren bemühte, merkwürdige, hilflose Wendungen, bei denen der renommierten, tapfer kämpfenden Übersetzerin Silvia Morawetz wohl die Haare zu Berge standen. Was ist beispielsweise damit gemeint, dass der Atem einer Frau aus dem Takt gerate, "wie wenn etwas zu fallen droht, das lange an einem Nagel oder ein einer Kette hing"? Und welchen sinnlichen Eindruck soll man bekommen, als Howard "kaltes, unerschrockenes Grün" riecht?
Paul Harding hat die Schreibkurse der Autorin und Essayistin Marilynne Robinsons an der Universität von Iowa besucht. Deren phantasievolle Metaphern beim Darstellen der amerikanischen Natur - oder die vergleichbaren Feuerwerke Joan Clarks, Louise Erdrichs, Timothy Findleys, Annie Proulx' oder Alice Munros - haben den Autor offenbar kaum inspiriert. Klare Spuren hinterließ dagegen die Anlage von Marilynne Robinsons Roman "Gilead" aus dem Jahr 2004, worin ebenfalls ein sterbender Senior seine Existenz bilanziert und symbiotische Beziehungen rekonstruiert. Allerdings benötigt Robinson keine ellenlangen Sätze, um Komplexität zu suggerieren; "Gilead" blendet nicht. Paul Harding, der den ehernen Gesetzen seines Metiers folgt und längst an der Fortsetzung seines ersten Romans sitzt, hat noch einiges zu tun.
THOMAS LEUCHTENMÜLLER.
Paul Harding: "Tinkers". Roman.
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz. Luchterhand Literatur Verlag, München 2011. 189 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main