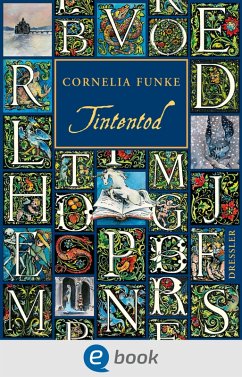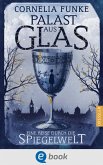Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Cornelia Funke und Kirsten Boie, Philip Pullman und Lemony Snicket: Die Jugendliteratur hatte schon lange keine so großen Namen und keine so guten Bücher mehr. Ausblick auf einen aufregenden Lese-Herbst.
Von Tilman Spreckelsen
Als der amerikanische Autor Daniel Handler jüngst gefragt wurde, ob er für erwachsene Leser anders schreibe als für Jugendliche, antwortete er, Erwachsene seien in der Regel älter. Sonst sehe er keinen Unterschied.
Handler, der unter dem Pseudonym Lemony Snicket gerade eine der klügsten und witzigsten Jugendbuchserien aller Zeiten mit dem dreizehnten Band abgeschlossen hat ("Eine Reihe betrüblicher Ereignisse"), macht es sich mit dieser Antwort natürlich leicht. Andererseits ist es seit "Harry Potter" keinem Erwachsenen mehr peinlich, wenn er mit einem Jugendbuch erwischt wird, und nicht wenige führen den erstaunlichen Siegeszug des Sachbuchs speziell für jüngere Leser darauf zurück, dass eben immer mehr Große etwa zum betreffenden "Was ist was"-Band greifen, wenn sie endlich die Evolution oder die Sache mit den Genen verstehen wollen.
Einen gravierenden Unterschied aber wird auch Handler nicht leugnen: Erwachsene kaufen sich ihre Bücher selbst, Kinder und Jugendliche bekommen sie geschenkt. Und zwar sehr oft von Erwachsenen, die entzückt aufschreien, wenn sie die "Häschenschule" oder "Die kleine Raupe Nimmersatt" neben der Ladenkasse liegen sehen und damit ihren Kindern oder Enkeln bescheren, was sie einst selbst geliebt haben. Nicht zuletzt deshalb sind die Bestsellerlisten für Kinder- und Jugendbücher auch übervoll mit guten alten Bekannten - selbst "Der kleine Prinz" mischt in diesem enorm konservativen Markt immer noch ganz vorne mit.
Um die Klassiker muss man sich also keine Sorgen machen, um die Neuerscheinungen schon. Vor Jahresfrist stellte die Jury zum deutschen Jugendliteraturpreis den Kinderbuchverlagen ein verheerendes Zeugnis aus, indem sie unter 5635 Büchern keine dreißig Titel fand, die sie auf ihre Shortlist setzen mochte. Eine "Ohrfeige für die Branche", fanden nicht nur die Jugendbuchexperten Monika Osberghaus und Friedbert Stohner, die in einem Aufsatz für die "Schweizer Monatshefte" wenig hoffnungsfroh in die Zukunft blicken: "Mit ihrer Entscheidung hat die Jury den Finger in eine Wunde gelegt, die von den meisten Kinderbuchmachern offenbar gar nicht als solche wahrgenommen wird. Wo sie bunte Bücherstapel genauso schnell verkaufen wie anhäufen können, sind sie erstaunlich schmerzfrei. Dass 99 Prozent ihrer Erzeugnisse aussortiert werden, weil sie nicht den Qualitätskriterien für ein wertvolles Kinderbuch entsprechen, stört sie nicht, solange diese Produkte an anderer Stelle vorne liegen, nämlich auf den Stapeltischen der großen Buchhandelshäuser." Und das seien dann "Fantasywälzer", "coole Girliebücher" oder auch die "wilden Fußballkerle".
Kann man es den Verlagen übelnehmen, wenn sie diejenigen Bücher herstellen, die sie für die verkäuflichsten halten? Natürlich nicht. Jedenfalls so lange nicht, wie neben Reihen wie "Freche Mädchen - freche Bücher" (deren Titel nur ungern ohne das Wort "Küsse" auskommen) oder den immer noch fortgesetzten Abenteuern von Hanni und Nanni auch das ambitionierte Bilderbuchprogramm von Verlagen wie Peter Hammer oder Moritz seinen Weg in die Buchhandlungen findet - und solange man sich davor hütet, mit verklärtem Blick Kinder und Jugendliche auf Teufel komm raus zum Lesen zu zwingen, die vielleicht gerade lieber Fußball spielen gehen würden.
Solange man also die Jugendliteratur lediglich als Teil eines Buchmarkts sieht, dessen Gesetzen sie aus guten Gründen unterworfen ist und in dem sie sich prächtig behauptet, gibt es keinen Grund zur Sorge. Der Anteil der Sparte wächst stetig auf mittlerweile über vierzehn Prozent des Gesamtumsatzes der Branche, und das bei eher niedrigen Verkaufspreisen der einzelnen Bücher. Im Ausland ist sie zudem erfolgreicher als die Erwachsenenliteratur: Jedes vierte Buch, das aus dem Deutschen in eine andere Sprache übersetzt wird, ist heute ein Kinder- oder Jugendbuch.
Von einer Nische mag da niemand mehr sprechen, zumal sich auch das Kino begierig den Verfilmungen aktueller Jugendliteratur öffnet: In diesem Jahr waren das bislang gleich zwei Titel von Cornelia Funke ("Die wilden Hühner und die Liebe" und "Hände weg von Mississippi") und "Herr Bello" von Paul Maar; für die Vorweihnachtszeit steht schließlich die aufwendige Adaption von Philip Pullmans "Der goldene Kompass" mit Stars wie Nicole Kidman und Daniel Craig an, vom aktuellen "Harry Potter"-Film ganz zu schweigen.
Vor allem aber findet sich in der Schwemme der Neuerscheinungen in diesem Jahr eine ganze Reihe von Büchern, die sich in ruhiger Selbstgewissheit nirgends anbiedern und die vom gewachsenen Markt profitieren, indem sie den Platz, den sie darin einnehmen, selbst bestimmen: Wer weiß, dass er auf ein Publikum rechnen kann, muss nicht notwendig das hundertste Drachenbuch, den zweihundertsten Jugendgewaltkrimi der Saison liefern. Tut er es doch, kann er dabei zumindest die vermeintlichen Gesetze des Genres auf das schönste ignorieren.
Am leichtesten haben es dabei naturgemäß Bände, die eine bereits freundlich aufgenommene Geschichte fortführen oder an ein Ende bringen. Das betrifft nicht nur die Potter-Saga, deren letzter Band im Oktober auf Deutsch bei Carlsen erscheinen wird, sondern auch Cornelia Funkes anspruchsvollere "Tintenwelt"-Trilogie. Funke beschreibt darin das Grenzgängertum des Mädchens Meggie, das die fiktionale Welt, wie sie in Büchern entworfen wird, gleichzeitig als verlockend und bedrohlich empfindet, und das im Wortsinn: Weil ihr Vater so suggestiv vorzulesen weiß, verliert Meggie ihre Mutter; erfundene Brandstifter fackeln ganz real eine Bibliothek ab, und wenn sie selbst mehrfach Todesängste ausstehen muss, wird sie dabei kaum trösten, dass ihre Peiniger die Kopfgeburten eines befreundeten Autors sind.
Funke vermeidet die naive Glorifikation des Lesens an sich, die sich mittlerweile auf dem Buchmarkt für Erwachsene ebenso pestartig breitmacht wie auf dem für Kinder- und Jugendliche, und das muss man ihr hoch anrechnen. Auch Daniel Handler alias Lemony Snicket ist davor gefeit, wenn er in seiner Serie um drei überaus unglückliche Waisen zwar auf jeder Seite mit literarischen Versatzstücken spielt, gleichzeitig aber die völlige Hilflosigkeit der freundlichen, gebildeten und erzvernünftigen Geschwister in einer aus den Fugen geratenen Welt schildert, in der sich jeder Glaube an Gesetzmäßigkeit oder gar Pläne als frommer Wunsch entpuppt. Und weil das Ganze, wunderbar durchgehalten über volle dreizehn Bände, am Ende schließlich in einen operettenhaften Trugschluss mündet, wird man den Autor für diesen Eigensinn preisen, selbst wenn er so ziemlich jede Frage offenlässt, die er bis dahin aufgeworfen hatte.
Auch Kirsten Boie, die mit "Alhambra" einen großartigen Zeitreiseroman vorlegt, braucht sich um ihre Akzeptanz beim Publikum keine Sorgen zu machen, zumal das Buch zum Besten gehört, was dieser Herbst zu bieten haben wird. Boie schickt einen deutschen Schüler, der mit seiner Klasse Granada besucht, plötzlich ins Jahr 1492, in die Zeit der Mauren- und Judenverfolgung durch Ferdinand und Isabella, und in die Zeit von Columbus, der um Unterstützung für seine geplante Indien-Fahrt ersucht. Und während der Schüler auf einen Moslem und einen Juden seines Alters trifft, während also die Sache durchaus auf eine platte Toleranzpredigt zusteuern könnte, die dann auch für unsere Gegenwart herhalten müsste, vermeidet Boie diese Untiefen und bringt ihr Anliegen dennoch elegant ans Ziel.
Es ist diese Sorgfalt, diese Scheu vor ausgetrampelten Pfaden der Jugendliteratur, die Autoren ihrer Klasse von einem Großteil derer trennen, die das Schreiben für Jüngere so verstehen, dass sie schlicht weniger bieten: weniger Einfälle, weniger sprachliche Brillanz. Das trifft auf jene in der Jugendliteratur notorischen Vielschreiber zu, die sich einiges auf ihre Produktivität einbilden, aber auch auf Debütanten, die sich nicht von der eigenen Lektüre lösen können und dann, mitunter sogar höchst erfolgreich, nichts als einen neuerlichen Aufguss vom "Herrn der Ringe" liefern.
Umso erfreulicher ist da Marlene Röders Debüt "Im Fluss": Die Geschichte einer Sommerfreundschaft auf dem Lande, aus drei Perspektiven erzählt, fügt souverän realistische und phantastische Elemente zu einer überzeugenden Einheit. In Röders Welt lassen sich die Guten und die Bösen nicht so einfach trennen, und dass sie am Ende dann doch nicht in einer moralischen Beliebigkeit versackt, ist kein geringes Verdienst.
Röders Buch ist nicht das einzige bemerkenswerte Debüt in diesem Herbst, neben den Bänden von Funke, Rowling und Snicket stehen andere, die ebenfalls große Jugendbuchserien abschließen, und dass mit "Flunkerfisch" eine weitere Zusammenarbeit der "Grüffelo"-Urheber Julia Donaldson und Axel Scheffler auf Deutsch erscheint, ist immer eine hübsche Sache. Die Jury des Jungendliteraturpreises sollte in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen. Von uns Lesern ganz zu schweigen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH