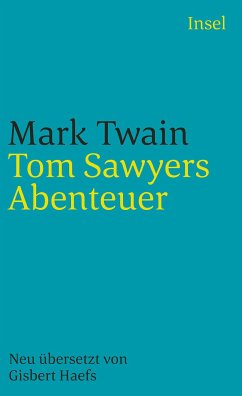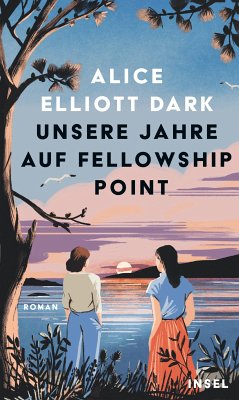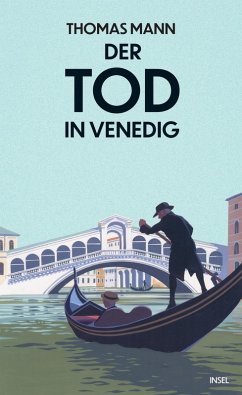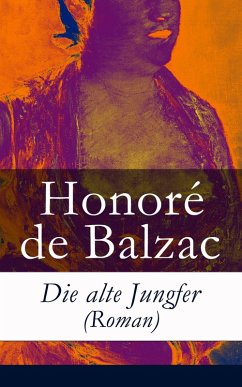Mark Twain
eBook, ePUB
Tom Sawyers Abenteuer (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 14,00 €**
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





In neuer, kongenialer Übersetzung: Tom Sawyers Abenteuer - die berühmte Geschichte eines cleveren Waisenkindes, das sich gegen die starren Regeln der Erwachsenen durchzusetzen weiß. Da haben Sonntagsschule, Tante Polly und puritanische Tugendvereine keine Chance, wenn es darum geht, zu schwimmen, zu rauchen und einen Mord aufzuklären - immer wieder ein Lesevergnügen für groß und klein.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.28MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden
- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit
Mark Twain wurde am 30. November 1835 als Samuel Langhorne Clemens in Florida / Missouri geboren. Nach dem Tod des Vaters brach er mit zwölf Jahren die Schule ab und arbeitete zunächst als Lehrling in einer Druckerei, später auch als Journalist, Goldgräber, Publizist und Lotse auf einem Mississippi-Dampfer. Twain machte Reisen u.a. nach Europa und Palästina, bevor er sich in Hartford niederließ und heiratete. Neben der Schriftstellerei unternahm er auch Vortragsreisen in der ganzen Welt. Twain wurde insbesondere durch die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer bekannt. Er gilt als einer der bedeutendsten amerikanischen Autoren des 19. Jahrhunderts und besticht besonders durch sein humoristisches und satirisches Talent. Noch zu seinen Lebzeiten starben seine Frau und die beiden Töchter, Twain selbst starb am 21. April 1910.
Gisbert Haefs, 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren, lebt als freier Autor und Übersetzer in Bonn. Er übersetzte u.a. Ambrose Bierce, Rudyard Kipling, Mark Twain und Jorge Luis Borges. Als Autor wurde er nicht nur durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen Bonner Privatdetektiv Baltasar Matzbach berühmt, sondern auch durch seine farbenprächtigen historischen Romane Hannibal, Alexander und Troja, die allesamt Bestseller waren.
Gisbert Haefs, 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren, lebt als freier Autor und Übersetzer in Bonn. Er übersetzte u.a. Ambrose Bierce, Rudyard Kipling, Mark Twain und Jorge Luis Borges. Als Autor wurde er nicht nur durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen Bonner Privatdetektiv Baltasar Matzbach berühmt, sondern auch durch seine farbenprächtigen historischen Romane Hannibal, Alexander und Troja, die allesamt Bestseller waren.

Produktdetails
- Verlag: Insel Verlag GmbH
- Seitenzahl: 298
- Altersempfehlung: ab 8 Jahre
- Erscheinungstermin: 18. November 2011
- Deutsch
- ISBN-13: 9783458759003
- Artikelnr.: 37091857
Broschiertes Buch
Tom ging den gewundenen Pfad entlang, zuerst nach rechts, dannmnach links. Huck folgte ihm auf den Fersen. Nach einer Weile bog Tom um eine scharfe Wendung und rief: Du meine Güte, Huck schau mal hier!<br />Ich finde das Buch sehr spannend, witzig, geheimnisvoll und lesewert, weil es gut …
Mehr
Tom ging den gewundenen Pfad entlang, zuerst nach rechts, dannmnach links. Huck folgte ihm auf den Fersen. Nach einer Weile bog Tom um eine scharfe Wendung und rief: Du meine Güte, Huck schau mal hier!<br />Ich finde das Buch sehr spannend, witzig, geheimnisvoll und lesewert, weil es gut beschrieben ist und ich besonders die Stelle als Tom und Huck den Mord beobachtet hatten und wie sie es geschafft haben auf ihrer eigenen Beerdigung anwesend zu seien. Alles im ganzen ein tolles Buch, aber die Zwischenromane mit Tom und Becky fand ich eher langweilig.
Ich empfehle das Buch weiter.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
In diesem Buch geht es um einen Jungen namens Tom der nicht unbedingt der artigste ist. Aber er will ja auch ein waschechter Pirat werden. Der Waisenjunge lebt bei seiner Tante, zusammen mit seinem Halbbruder Sid und seiner Cousine Mary im kleinen Ort St. Petersburg am Mississippi.
Das …
Mehr
In diesem Buch geht es um einen Jungen namens Tom der nicht unbedingt der artigste ist. Aber er will ja auch ein waschechter Pirat werden. Der Waisenjunge lebt bei seiner Tante, zusammen mit seinem Halbbruder Sid und seiner Cousine Mary im kleinen Ort St. Petersburg am Mississippi.
Das Abenteuer seines Kinderlebens beginnt als Tom und sein Freund Huck eines Nachts die einzigen Zeugen eines Mordes sind. Zwischen Indianer Joe, Muff Potter und dem Arzt Robinson kam es zum Streit. Potter stürzte sich, mit seinem Messer in der Hand, auf den Arzt. Doch er verlor seine Waffe und wurde obendrein noch bewusstlos geschlagen. Aber ehe Robinson sich versah, erstach ihn Joe mit Potters Messer. Joe schob die Schuld auf Muff Potter. Die Jungen schworen sich nicht zu verraten, doch als das Gericht entschied Potter zu hängen, griff Tom ein.<br />Mir hat das Buch gefallen, weil es mich oft zum lachen gebracht hat. Außerdem ist es sehr spannend. Ich wurde das Buch auf jedem Fall weiterempfehlen. Ich bin auf diesen Jugendroman gestoßen als ich mal wieder ein gutes Buch lesen wollte und da kam mir dieses bekannte gerade recht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für