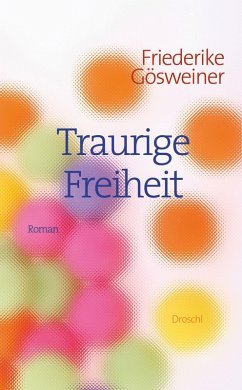Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Berliner Illusionen: Friederike Gösweiners beeindruckendes Romandebüt "Traurige Freiheit"
Was ist eigentlich aus der Generation Praktikum geworden? Angesichts globaler Krisen könnte man meinen, dass es sich bei den prekären Beschäftigungsverhältnissen hochqualifizierter Geistes- und Sozialwissenschaftler um ein Luxusproblem der letzten verbliebenen Wohlstandsoasen handele. Das unverwüstliche Mantra vom "Aufstieg durch Bildung" und die beeindruckenden Erwerbsquoten schaffen ein zusätzliches Wahrnehmungsproblem, zumal es sich bei den Betroffenen nicht um eine marginalisierte Randgruppe, sondern um eine hochmotivierte und meinungsstarke Bildungselite handelt, der zu ihrem Glück lediglich eine feste Stelle im Universitäts- oder Kulturbetrieb fehlt.
In Friederike Gösweiners Debütroman "Traurige Freiheit" hat es die Protagonistin Hannah kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag immerhin bis zur nächsten Stufe geschafft: Ein achtwöchiges Volontariat bei einer Berliner Tageszeitung verheißt ihr eine "Riesenchance". Ihr Freund Jakob, ein aufstrebender Assistenzarzt, ist von der Aussicht auf eine Fernbeziehung wenig erbaut, denn er mag schlicht nicht über Skype, Facebook und Twitter kommunizieren - "diesem ganzen virtuellen Käse. Ich mag live."
Gösweiner lässt diese Figuren in vermeintlich schlichter Sprache aufeinander los. Durch feine Nuancierungen schafft sie es, einen typischen Streit zu schildern, in dem doch das ganze Elend der Geschlechterverhältnisse und heutigen Beziehungsmodelle aufscheint. Jakob hätte nämlich kein Problem, seiner Freundin vorläufig bei der Miete auszuhelfen, damit sie sich ohne die Unwägbarkeiten eines Ortswechsels nach einer passablen Arbeit umsehen kann. Doch diese rebelliert ebenso nachvollziehbar gegen eine drohende Abhängigkeit. Die ökonomischen Verhältnisse verweisen emanzipatorische Selbstbilder in ihre Schranken.
Auch Berlin fällt als Sehnsuchtsort aus, dabei wimmelt es im Newsroom der Tageszeitung vor kreativem Potential. Es ist der letzte Tag von Hannahs Volontariat. Sie ist eine von acht, deren Einstieg in den professionellen Journalismus zu kaum mehr als einer Zeile im Lebenslauf zerbröselt. Eilig werden für die Verabschiedung belegte Brote, Schokolade und Sekt aufgetischt, der kumpelhaft-schmierige Chefredakteur spornt routiniert zu noch mehr Leistung an und befeuert die Konkurrenz, doch zur erhofften Festanstellung kommt es natürlich nicht. Stattdessen treibt sich die Protagonistin danach an allerhand Nichtorten herum, von denen Berlin wahrlich genug besitzt. Wer den Starbucks am Alex kennt, sehnt sich zwangsläufig zurück in die Provinz. Dass das Einkaufen in der Filiale einer Billig-Modekette mit in Klamottenbergen wühlenden Kundinnen und "synthetischer Musik mit unbarmherzig hektischem Beat" kein Vergnügen ist, wird beiläufig beschrieben.
Gegen den Lärm und andere ästhetischen Zumutungen hilft allein die Staatsbibliothek als gedämpfter Rückzugsort: "Niemand sprach ein Wort, es wurde nur gelegentlich geflüstert, alle saßen über ihren Büchern, schrieben, lasen oder schliefen, den Kopf auf die überkreuzten Arme gebettet." Hannah hat aber kein Projekt, das ihren Aufenthalt dort rechtfertigen würde. Ihr geht es nur darum, gegen die "Zeitverbreiung" (Sven Hillenkamp) den Anschein eines geregelten Tagesablaufs aufrechtzuerhalten.
Mitten in die kontemplative Atmosphäre platzt eine Skype-Nachricht von Miriam, Hannahs Freundin und Berliner Quartiergeberin, die es inzwischen zur Moskau-Korrespondentin eines Fernsehsenders gebracht hat. Wie unter Freundinnen üblich, werden Beziehungsfragen küchenpsychologisch hin und her gewendet. Miriam leidet darunter, dass ein "sehr viel älterer OECD-Beauftragter" verheiratet ist und mir ihr nur eine Affäre will, während die unglückliche Hannah nicht über ihren "Trennungs-Liebeskummer" mit Jakob hinwegkommt. Ja, zwischen ihr und Jakob herrscht Funkstille, obwohl fast täglich elektronisch kommuniziert wird. Doch die dauerironische und zugleich mit banalen Motivationstipps aufwartende Kommunikation zwischen besten Freundinnen ist eigentlich noch erschütternder.
In diesem präzise gebauten Roman sind die Motivstränge locker verwoben, für Spannung sorgen ein attraktiver Unbekannter und das vermeintliche Verschwinden Miriams. Wichtiger als die äußere Entwicklung - Hannah kellnert zwischenzeitlich in einem Prenzlauer-Berg-Café - ist die Evokation eines ambivalenten Zustands: "zornig und traurig zugleich", wie es gleich am Anfang heißt. Klischeehafte Erwartungen werden durchbrochen, etwa wenn unter Redakteursanwärtern "ausgerechnet der Kerl im Anzug" gegen das skandalöse Salär von 495 Euro protestiert, das sich alle anderen schönreden.
Es gehört zu den Stärken dieses schmalen Büchleins, dass es nicht einfach soziologische Befunde oder persönliche Befindlichkeiten in Literatur übersetzt. "Traurige Freiheit" wird vermutlich gerade bei jenen erhebliche Abwehrreflexe hervorrufen, deren Schicksal hier kompromisslos erzählt wird: also bei all jenen "Kreativen", die Berlin für den Nabel der Welt halten und deren Status als Intellektuelle sie lediglich dazu befähigt, in Geschmacksfragen eine Fähigkeit zur Distinktion zu entwickeln, die sie als Angehörige des linksliberalen Establishments ausweist.
Die Jury des erstmals vergebenen Österreichischen Buchpreises hat mutig gehandelt, als sie Friederike Gösweiner kürzlich den Debütpreis zuerkannte. Nicht der Rückzug in die naturpoetische Innerlichkeit eines Handke oder der zermalmende Furor Bernhards und Jelineks sind dieser Prosa wahlverwandt; Gösweiner knüpft vielmehr an die Bewusstseinskrise der klassischen Moderne an. Rilkes Malte Laurids Brigge, der Protagonist des wohl ersten modernen deutschsprachigen Großstadtromans, flüchtete wie Hannah vor den Gefahren der Zeitverbreiung in die Pariser Bibliothèque Nationale. Von ihm könnte auch das Motto zu Friederike Gösweiners "Traurige Freiheit" stammen: "Ich glaube, ich müßte anfangen zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne." Wenn das mal so einfach wäre.
STEFAN KLEIE
Friederike Gösweiner: "Traurige Freiheit". Roman.
Literaturverlag Droschl, Graz 2016. 144 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main