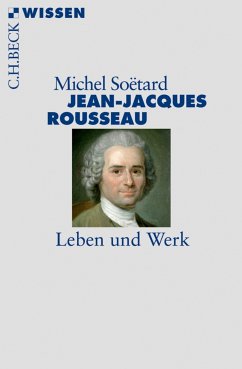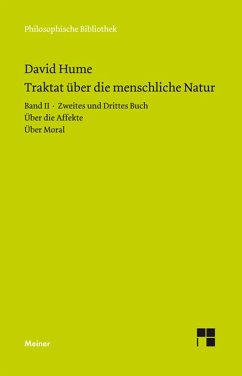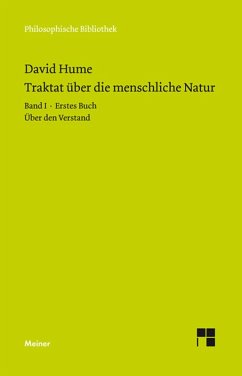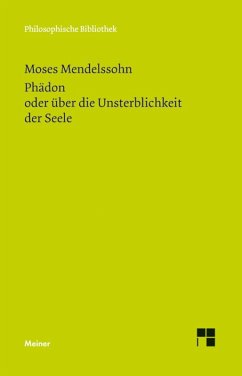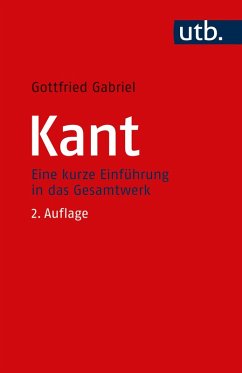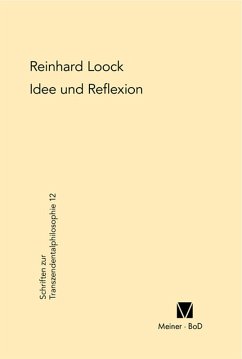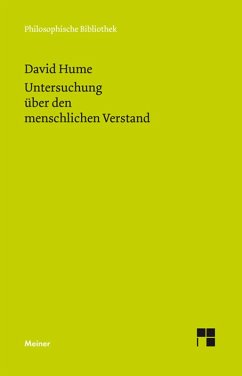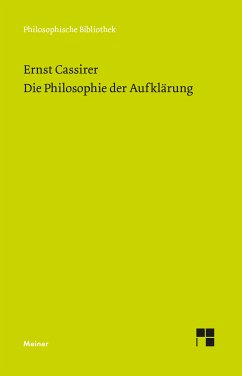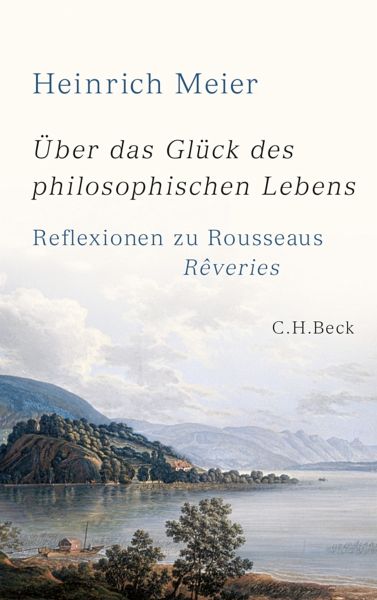
Über das Glück des philosophischen Lebens (eBook, PDF)
Reflexionen zu Rousseaus Rêveries in zwei Büchern
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 29,95 €**
22,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Rêveries sind das schönste und das gewagteste Buch von Jean- Jacques Rousseau. Sie zeigen das Feuer der Philosophie im Widerschein des Wassers, in den Spiegelungen des Unbegrenzten, das näherer Bestimmung, des Unauffälligen, das sorgfältiger Betrachtung, der Oberfläche, die eingehender Auslegung bedarf. Sie gipfeln in einer poetischen Darstellung des Glücks, das das philosophische Leben eröffnet. Heinrich Meiers eindringliche Auseinandersetzung mit der letzten und am wenigsten verstandenen Schrift Rousseaus besteht aus zwei Büchern, die sich gegenseitig erhellen. Das erste unterni...
Die Rêveries sind das schönste und das gewagteste Buch von Jean- Jacques Rousseau. Sie zeigen das Feuer der Philosophie im Widerschein des Wassers, in den Spiegelungen des Unbegrenzten, das näherer Bestimmung, des Unauffälligen, das sorgfältiger Betrachtung, der Oberfläche, die eingehender Auslegung bedarf. Sie gipfeln in einer poetischen Darstellung des Glücks, das das philosophische Leben eröffnet. Heinrich Meiers eindringliche Auseinandersetzung mit der letzten und am wenigsten verstandenen Schrift Rousseaus besteht aus zwei Büchern, die sich gegenseitig erhellen. Das erste unternimmt es, in ständiger Rücksicht auf die Rêveries das philosophische Leben zu denken. Seine sieben Kapitel sind überschrieben: Der Philosoph unter Nichtphilosophen, Glaube, Natur, Beisichselbstsein, Politik, Liebe, Selbsterkenntnis. Das zweite gibt eine neue Auslegung des umstrittensten Werkes von Rousseau, des Glaubensbekenntnisses des Savoyischen Vikars, das ein gelungenes nichtphilosophisches Leben grundzulegen sucht. Die Rêveries verweisen den Leser nachdrücklich auf das Glaubensbekenntnis, das 1762 als Teil des Emile erschienen war und Rousseau die politische Verfolgung durch die kirchlichen und weltlichen Autoritäten seiner Zeit eintrug.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.