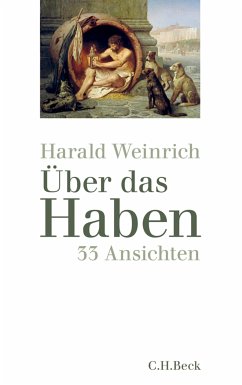Auf dem Umschlag dieses Buches begrüßt uns Diogenes von Sinope, der nichts haben will, nicht einmal von Alexander dem Großen. Er ist freilich eine Ausnahme. Die meisten Menschen haben gern, und deshalb mangelt es auch nicht an Gründen und Anlässen, sich über das Haben zu äußern. In einer höchst unterhaltsamen Reise durch die Sinnwelten des Habens eröffnet Harald Weinrich, der Grandseigneur der europäischen Sprachwissenschaft, verblüffende Einsichten in unseren Gebrauch des Wörtchens Haben – und unser Haben-Denken, das sich darin offenbart.

Auf dem Weg genauer Sprachkenntnis zu anthropologischen Einsichten: Harald Weinrich widmet sich in seinem neuen Buch unserer vielfältigen Rede vom Haben und der reichen Literaturgeschichte des Besitzens.
Die Minderschätzung des Habens ist eine Konstante der europäischen Ideengeschichte. Große Bücher heißen, selbst wenn sie das Haben mitbehandeln, einfach nicht "Haben und Zeit" oder "Das Haben und das Nichts" oder "Die Welt als Wille und Habe". Dabei ist das entsprechende Verb ja durchaus nicht weniger ruhelos im Einsatz als "sein" oder "denken": Der Mensch "hat" Vernunft, Sorgen, Likör, Geschichte, Gefühle, Geist, Schwimmunterricht und so weiter.
Doch das Eigentum im engeren Sinne überließ die Philosophie zumeist gern den Juristen und noch für die wenigen, die es anders hielten, war die Habe nicht viel mehr als Ausdruck getaner Arbeit oder vollzogener Wegnahme. Das Eigentum im weiteren Sinne wiederum galt als abgeleitet aus dem Sein. Schopenhauers Satz "Zu dem, was einer hat, habe ich Frau und Kinder nicht gerechnet; da er von diesen vielmehr gehabt wird" gehört da schon, an den Grenzen der Grammatik, zu den helleren Reflexionen aufs Haben.
Harald Weinrich, der Nestor der deutschen Linguistik, legt nun Variationen auf das Haben vor, die ihrerseits der Ontologie (Seinslehre) nun keine Echo- oder Hexologie entgegensetzen wollen, was die entsprechenden griechischen Ausdrücke wären. Vielmehr möchte Weinrich darauf hinweisen, dass man vieles nur sein kann, wenn einem etwas gehört oder zugeordnet ist.
Das Verb "haben" bezeichnet solche Zugehörigkeiten, so wie "sein" Erkennbarkeit festhält, wobei eins ins andere übersetzt werden kann. Mit Weinrichs Beispiel: "Wir haben Gäste" bedeutet "Wir sind (gerade) Gastgeber"; oder in vielen Sprachen "Uns sind Gäste". Verwandterweise bezeichnet "haben" als Hilfsverb Vergangenes, das der Gegenwart noch zugehört ("Was hast Du getan?"). Und in der Interaktion wird Höflichkeit gerade vermittels einer Variation von Zugehörigkeitsvermutungen gewahrt: Hätten Sie vielleicht, ich hätte gern gewusst, man hätte doch.
Weinrichs Ansichten sind meist linguistischer, oft philosophischer, kunst- und literaturgeschichtlicher oder sprachgeschichtlicher Art. So lesen wir mit ihm Beispielsätze wie "Bis zur Grenze hatten sie noch drei Kilometer", was in einem DDR-Wörterbuch zusammen mit "Haben Sie Apfelsinen?" und "Früher hatten wir kein Russisch" ebenso bemerkenswert ist wie die ausschließliche Exemplifikation des "Habens" im Duden durch Sachen. Nur Autos, Eigentum, Häuser werden da gehabt, nicht Kopfschmerzen, Angst oder Glück.
Oder wir folgen seiner bezwingenden Interpretation von Emily Dickinson ("I had no time to Hate - / Because / The Grave would hinder me -") als Gegenwort zu "Ein jegliches hat seine Zeit" (Prediger Salomo). Stets sind es nur wenige Seiten, die Weinrich an solche Motive wendet - an das "Haben als hätte man nicht" des Paulus oder an das "Kriegen" als Gegenstück zu Haben - aber jedes Mal bekommen wir mehr als dasteht: Skizzen, die Aufsätze enthalten. Im Ganzen bekommen wir keine Theorie, aber ein Seminar. Fast meint man, dass es vom großen Fremdsprachen-Lehrer Weinrich, genauer: dem Erfinder des Faches "Deutsch als Fremdsprache" gegeben wird, in dessen Schulstunde auch die Muttersprachler merken, was alles im Deutschen steckt.
Ganze Aufsätze stecken besonders in seinen Kommentaren zur Literaturgeschichte des Besitzens. Vor allem diejenigen, die anscheinend nur noch sich selbst haben, interessieren ihn da: Robinson Crusoe etwa, der Scheinhabenichts, der allerdings eine Erstausstattung an Werkzeug, Pulver, Tinte und Papier besaß, das arme Mädchen aus dem Sterntaler-Märchen, das zuletzt alles hergegeben hatte, oder Salomon und Veronika in Gottfried Kellers "Romeo und Julia auf dem Dorfe", die nur noch einander hatten. Die vier Seiten über Hitlers Selbstbezeichnung als Habenichts in einer Welt der Besitzenden enthalten ein ganzes Buch.
Harald Weinrich knüpft mit seinen Kommentaren zu intellektuellen und sprachlichen Habunseligkeiten an Bücher über die Lüge, das Vergessen, die Heiterkeit sowie die Knappheit der Zeit und die Moral an, die er neben seinen großen linguistischen Werken zur Erzähltheorie sowie zur Textgrammatik des Französischen und Deutschen vorgelegt hat. Im Stil wie in der Motivwahl gibt sich das Vorbild der französischen Moralistik für den zu erkennen, der durch die Wissenschaft hindurch auf anthropologische Einsichten zielt. Forschung, die Lehre sein möchte und darum lieber bruchstück- als zwanghaft ist: gut, dass wir Harald Weinrich haben. Heute hat er selbst seinen fünfundachtzigsten Geburtstag.
JÜRGEN KAUBE
Harald Weinrich: Über das Haben. 33 Ansichten.
Verlag C. H. Beck, München 2012. 207 S., Abb., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Geradezu ins Schwärmen gerät Johan Schloemann über Harald Weinrichs Buch "Über das Haben". Der "Altmeister der Sprach- und Literaturwissenschaft" liefert für ihn eine höchst unterhaltsame, gebildete und leichthändige Untersuchung eines Alltagsworts, an das große Themen geknüpft sind. Diesen nähert sich der Autor zur Freude des Rezensenten in ebenso gedankenreichen wie amüsanten Skizzen. Dabei kommen Verb und Grammatik von "haben" ebenso zum Zug wie das Thema Haben in Philosophie und Literatur, in Wörterbüchern und Börsenromanen, in Wirtschaft und Alltag. Schloemanns Fazit: das ideale Geschenkt für alle, "die schon alles haben, aber auch für die, die gerne mehr hätten".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH