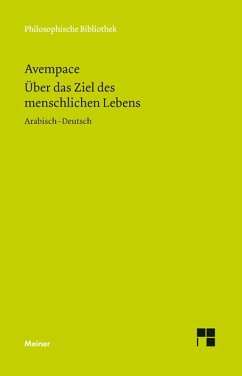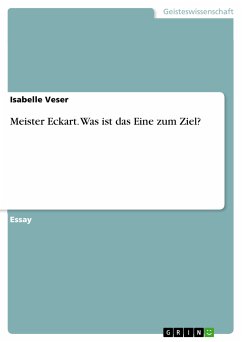Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wiederentdeckt: Der arabische Philosoph Avempace
Seit der Antike beschäftigt die Frage, was das Ziel des menschlichen Lebens sei, die Philosophen. Islamische Philosophen, die "Denker des Propheten", wie man sie genannt hat, standen da nicht abseits. Die von den Griechen beeinflusste "arabische" Philosophie, an der auch Perser und Berber teilhatten, erlebte ihre Höhepunkte zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert, vornehmlich in Iran, im Irak (Bagdad) und in Andalusien sowie im Maghreb, dem arabischen "fernen Westen".
Philosophie im strengen Sinne wurde dort etwa ein Jahrhundert lang getrieben. Während Ibn Ruschd (1126 bis 1198), im lateinischen Mittelalter Averroes genannt, zu frühem Weltruhm gelangte mit seinen Thesen von der "Einheit des Intellekts" und der "doppelten Wahrheit" und Abu Bakr Ibn Tufail (1105-1185), für die Lateiner Abu Bacer, mit seinem tiefsinnigen Roman vom "Philosophus autodidactus" das Vorbild für die Geschichte von Robinson Crusoe schuf, ist Ibn Baddscha oder Avempace weit weniger bekannt. Verdienstvoll ist es deshalb, dass nun eine Ausgabe von kleinen Traktaten des Avempace vorgelegt wird. Die arabischen Originaltexte sind ebenfalls abgedruckt, zusammen mit einem Glossar der wichtigsten philosophischen Termini in arabischer Sprache.
Viel Gesichertes ist über das Leben Avempaces nicht bekannt. Er stammte aus Saragossa, wo er um 1085 geboren wurde. Es war das Jahr, in dem die christlichen Spanier den Mauren die Stadt Toledo entrissen, geographisch im Zentrum der Iberischen Halbinsel gelegen. Die Glanzzeit des maurischen Andalus war da schon weitgehend zu Ende, in Saragossa wurde jedoch unter den Banu Hud noch eine Zeitlang die convivencia, die kulturelle "Zusammenarbeit" zwischen Muslimen, Christen und Juden, gepflegt. Davon profitierte auch Ibn Baddscha bei seiner Ausbildung. Der Gelehrte war, wie damals üblich, in vielen Sätteln gerecht: Musik und Medizin, Juristerei und Philosophie. Bemerkenswerte Kenntnisse scheint er besonders in Astronomie, Physik und Mathematik gehabt zu haben. Nach dem Siegeszug der Almoraviden-Dynastie, mit der der Fundamentalismus Einzug hielt, veränderte sich das geistige Klima, Ibn Baddscha verließ Saragossa und hatte offenbar einige Posten an lokalen Fürstenhöfen innerhalb der almoravidischen Herrschaft inne. Gestorben ist er 1139 in Fes.
Die muslimischen Autoren hellenisierender Richtung, die meistens in Arabisch, seltener in Persisch schrieben, wurden geprägt von den platonisch oder aristotelisch ausgerichteten antiken Traditionen. Doch auch der über al Farabi (gestorben 950 in Damaskus) verbreitete Neoplatonismus eines Plotin und Proklos mit seiner Emanationstheorie fand bis in den fernen Westen der islamischen Welt Verbreitung; ebenso die Mystik, die zumindest teilweise auch rationalistisch interpretiert wurde. Wichtig wird die Lehre vom aktiven Intellekt (intellectus agens), die später auch in der lateinischen Scholastik von Bedeutung sein sollte. Der Herausgeber und Übersetzer Franz Schupp interpretiert in seiner Einleitung Avempaces Auffassung in Richtung auf die rationalistische Tradition, die später in Averroes kulminiert, während die stärker mystisch ausgerichtete Auslegung dieser Intellektvorstellungen bei Ibn Arabi im frühen 13. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht.
Schupp legt drei Arbeiten Avempaces vor: den einleitenden Abschnitt aus dem Werk "Die Richtschnur des Einsamen", den Traktat "Über das Ziel des menschlichen Lebens" und die Abhandlung "Über die diesseitige und die jenseitige Glückseligkeit". Wie die antiken Philosophen sucht auch der Muslim Ibn Baddscha im Werden und Vergehen etwas, das jenseits der sinnlichen Welt Dauer verleiht, denn nur ein solches Gut vermag dem Menschen Glückseligkeit (die Eudaimonia des Aristoteles, arabisch: saada) zu verschaffen. In der "Richtschnur" legt Avempace dar, dass sich der Philosoph - anders als es etwa al Farabi und Aristoteles lehrten - von der Gesellschaft zurückziehen müsse, denn in ihr sei dieses dauerhafte Gut nicht festzumachen, sondern nur in der nach wahrer Erkenntnis strebenden Aktivität des Intellekts. Im zweiten Traktat heißt es, "dass dieses Ziel eine ewiges ist und dass es nichts Entstandenes und Vergehendes ist". Es schenke innere Ruhe und innere Gelassenheit, da es den materiellen und vergänglichen Dingen enthoben sei. Im dritten Traktat widerspricht er al Farabi, der die Fortdauer der Seele nach dem Tod als "Altweibergeschwätz" bezeichnet haben soll; al Farabi könne dies nie und nimmer behauptet haben. Die Vernunftbegriffe, zu denen der Intellekt gelangt, zielen auf die immaterielle Erste Ursache.
Die Gedanken Avempaces über die Glückseligkeit des Menschen und sein Lebensziel erinnern stark an einen Philosophen der Neuzeit, der freilich Wurzeln auf der Iberischen Halbinsel hatte: Baruch Spinoza. Der sah in der Erkenntnis der allgemeinen Wahrheit ebenfalls jenes dauerhafte Gut, das Glückseligkeit verheißt, ja als amor Dei intellectualis - als intellektuelle Liebe zu Gott - sogar eine Form der Erlösung.
WOLFGANG GÜNTER LERCH
Avempace: "Über das Ziel des menschlichen Lebens". Arabisch-Deutsch.
Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen von Franz Schupp. Felix Meiner Verlag, Hamburg 2015. 372 S., geb., 48,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main