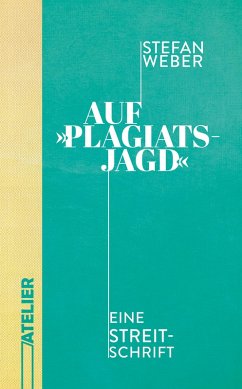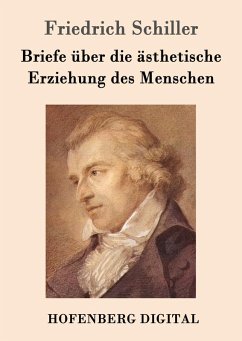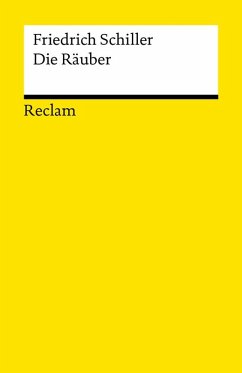Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (eBook, ePUB)
Mit den Augustenburger Briefen
Sofort per Download lieferbar
Statt: 8,40 €**
5,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Enthalten sind auch die sog. »Augustenburger Briefe» sowie die Ankündigung der »Horen». Der umfangreiche Anhang bietet Informationen zur Entstehungsgeschichte, eine Konkordanz der »ästhetischen» und der »Augustenburger» Briefe, Kommentar, Literaturhinweise und Nachwort. Alle Texte sind in originaler historischer Orthographie wiedergegeben. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.