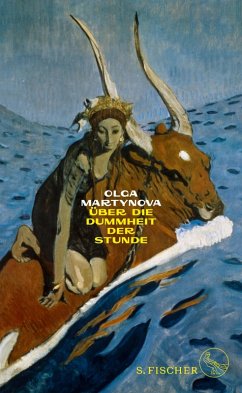Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

"Über die Dummheit der Stunde": Die Essays der deutschrussischen Schriftstellerin Olga Martynova
Mehr als alles andere fürchtet Olga Martynova das, was sie Kollektives Denken nennt. Die in Sibirien geborene Frankfurter Lyrikerin, die russische Gedichte und deutsche Prosa schreibt, hat wohl auch deswegen ein untrügliches Gespür für den diskursiven Herdentrieb, weil die Schmerzlinie der europäischen Kultur durch sie selbst hindurchgeht. In ihrem neuen Essayband will Martynova zeigen, dass Intellektuelle keineswegs gegen ihn gefeit sind, zumal wenn sie über aktuelle Streitthemen Bescheid zu wissen glauben und auf das einfache Volk herunterschauen. Vor allem im postsowjetischen Raum, aber zunehmend auch im liberalen Westen hätten die Menschen wieder Appetit auf Propaganda, was sich, wie die Autorin glaubt, in historischen Kataklysmen entladen könnte. Wie um die Optik ihrer Leser von Staub zu befreien, hält Martynova ihre tiefenscharfen Lektüren moderner Lebens- und Kulturpalimpseste dagegen.
Joseph Brodsky, den die Dichterin gern zitiert, hat die Lage des Poeten unter einer Diktatur als Bemühen geschildert, mit dem Kopf eine Wand zu durchbrechen, was seinen physischen Zustand gefährde. In einem freien Land hingegen reagiere die Wand nicht, und das gefährde seinen psychischen Zustand. Olga Martynova kennt die Versuchungen beider Systeme. Noch unlängst hätte man sie eine Weltbürgerin nennen können, doch sie bezeichnet sich lieber als Mensch mit zerstückelter Kulturzugehörigkeit, überzeugt, dass dies künftig die Norm sein werde. In verstreuten Aufsätzen, von denen einige zuerst in diversen Feuilletons erschienen sind, zeigt sie am Beispiel der finnischen Baukunst und des Kalevala-Epos, dass in Helsinki die gleichen Geister und Dämonen spuken wie in ihrer früheren Heimatstadt Petersburg. Sie extrapoliert einen alternativen Lebensweg des in Warschau geborenen Petersburger Dichters Ossip Mandelstam mit seiner Dauersehnsucht nach Europa, der, wäre er 1910 von seinem Studienaufenthalt in Heidelberg nicht heimgekehrt, auch in einem Lager gestorben wäre, nur in einem deutschen statt in einem sowjetrussischen. Und sie schildert, wie die im Pariser Exil verarmte und vereinsamte Marina Zwetajewa sich ein nächstes Leben erdichtete, in Deutschland, wo ein Casanova sie lieben und verlassen und wo sie seinen Sohn großziehen und seine uferlose Liebe weitertragen würde.
Als Lyrikerin lässt Martynova sich von Assoziationen tragen, was den Textduktus manchmal erratisch macht. Analytische Exkurse wechseln ab mit Sprachexperimenten, Reiseprotokollen, Kochrezepten. Doch der Off-Road-Leser wird reich belohnt. In dem Zentralstück mit dem thematisch nichtssagenden Titel "Probleme der Essayistik" vergleicht sie den gegenwärtigen Kampf um Europa mit jener Szene aus Ovids Metamorphosen, in der die asiatische Prinzessin sich dem schneeweißen Stier mit der hängenden Halswamme und den klitzekleinen Hörnern anvertraut. Sie erinnert sich, wie sie bei einer Podiumsdiskussion über Europa mit älteren Herren debattierte, die den Kontinent, dem sie ihre Liebe erklärten, mit der EU gleichsetzten, was die Autorin abwegig findet. Diese "alten weißen Männer" seien ihr wie Reinkarnationen jenes weißen, irgendwie unbedrohlichen, aber seinen Besitz verteidigenden Stiers vorgekommen, schreibt Martynova. Und die Flüchtlinge, die übers Meer kommen, vergleicht sie mit Europas Brüdern, die, der antiken Überlieferung zufolge, aus Kleinasien ausschwärmten, tückische Gewässer überquerten, um die Schwester zu finden.
Mit besonderem Gewinn liest man Martynovas Kommentare über die russische Gesellschaft und die russisch-ukrainischen Debatten. Sie hat keine Hemmungen, viel berühmtere Schriftstellerkollegen aus ihrer ersten Heimat für Pauschalurteile über das eigene Volk zu kritisieren. Wenn der in der Schweiz lebende Michail Schischkin wettere, Russland wäre ein Gefängnisland, wo die kriminelle Subkultur und Gaunermoral herrschten, wenn Wladimir Kaminer in Berlin behaupte, die Russen lägen nur apathisch vorm Fernseher, und wenn die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch erkläre, die Russen wären bereit, für heroische Ideen zu sterben, ihre Gesellschaft wäre bellizistisch, so seien dies verantwortungslose, schablonenhafte Aussagen, die keiner Erkenntnis dienen, sondern den Sprecher als der Partei der "Guten" zugehörig positionierten, meint Martynova. Mit dem indischen Schriftsteller Pankaj Mishra erblickt die Deutschrussin in dem neuen Aufstand sich erniedrigt fühlender Massen, den "populistische" Politiker wie Putin, Erdogan und Trump anführen, eine schreckliche, aber auch geradezu gesetzmäßige Antwort auf den globalen Fortschritt.
Erhellend, egal ob man Martynova folgen will oder nicht, ist auch ihre Deutung des Gedichts "Auf die Unabhängigkeit der Ukraine" von Joseph Brodsky, mit dem der Dichter sich in Kiew postum fast zum Staatsfeind gemacht hat. Die 1991 entstandenen, seinerzeit unveröffentlichten Verse sind ein sarkastischer Abschiedsgruß an die Ukrainer, die, nachdem sie gemeinsam mit den Russen "den Hals in die Schlinge" gesteckt hätten, am Hühnerbein aus dem Borschtsch, wie Brodsky sich ausdrückt, "lieber alleine nagten". Brodsky habe oft gesagt, dass das furchtbare Leid, das die Menschen unter dem Kommunismus erfuhren, eigentlich gegenseitiges Mitleid hätte erzeugen müssen, schreibt Martynova, die es wie dieser bedauert, dass nach dem Ende des Sowjetimperiums die alten Nationalismen, von mangelhafter Vergangenheitsbearbeitung verstärkt, sich wieder erhoben haben. Zwar stehe den Russen, die siebzig Jahre wie unter Tarzan gelebt hätten, kein Urteil zu, heißt es bei Brodsky. Doch dass er unter Ukrainern außer "Adlern" auch "Gefängniswärter" erblickt und behauptet, in ihrer Todesstunde würden sie Puschkin-Strophen röcheln, nahmen selbst russische oppositionelle Intellektuelle als Beweis dafür, dass Brodsky vom großrussischen Imperialismus infiziert gewesen sei.
So gerät das Krim-Tagebuch der Autorin, die im vergangenen Sommer die annektierte Halbinsel besucht hat, zur ebenso stillen wie nachhaltigen Polemik gegen eine Debatte, die sich für die kulturell hochkomplexe Region nur als geopolitisch-völkerrechtlichen Zankapfel interessiert. Sie schildert die paradiesische Landschaft, Begegnungen mit türkisch-jüdischen Karäern, die froh sind, zu Russland zu gehören, mit dem Dichter Andrej Poljakow, der auch darüber froh ist, weil er sich kulturell Russland zugehörig fühlt, dem deswegen aber Moskauer Kollegen die Freundschaft aufgekündigt haben. Man erfährt von steigenden Preisen, krimspezifischen Putin-Plakaten, von überraschend gutem Krimwein und davon, dass der Kult des letzten Zaren den bisherigen Puschkin- und Tschechow-Kult immer mehr verdrängt. Wobei es die ruhigen, oft traurigen Stimmen ihrer Gesprächspartner sind, die die Autorin davon überzeugen, dass sie sich über ihren Part in der Geschichte keine Illusionen machen.
KERSTIN HOLM
Olga Martynova: "Über die Dummheit der Stunde". Essays.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2018. 300 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH