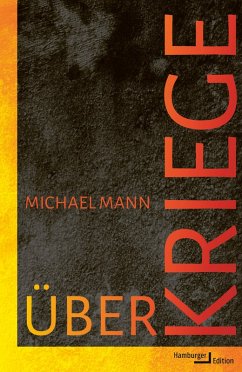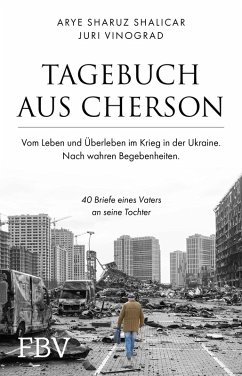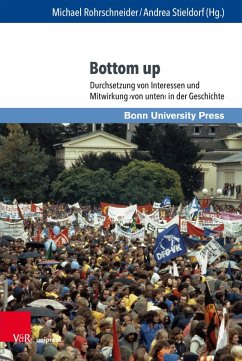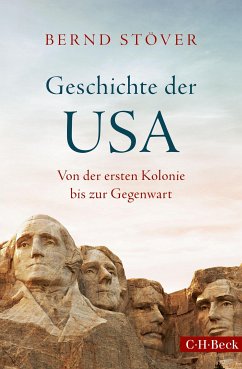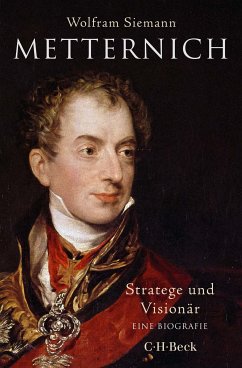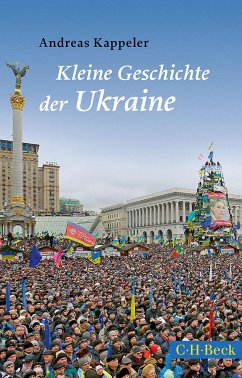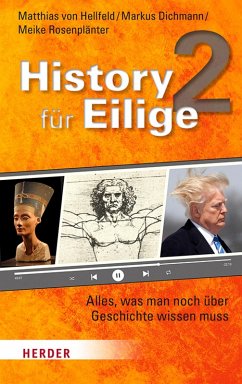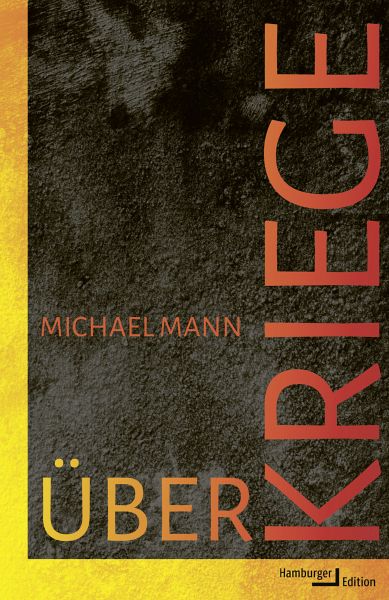
Über Kriege (eBook, PDF)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 45,00 €**
40,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Warum werden Kriege geführt? Was ist ausschlaggebend für die Entscheidung zum Krieg? Michael Mann erzählt die Geschichte des Krieges vom antiken Rom bis zum Überfall auf die Ukraine, vom kaiserlichen China bis zu Auseinandersetzungen im Nahen Osten, von Japan und Europa bis zur postkolonialen Geschichte Lateinamerikas und zu den Kriegen der Vereinigten Staaten. Obwohl sich die Waffen und die Organisation des Krieges im Laufe der Zeit enorm gewandelt haben, hat sich der Charakter der Entscheidungsprozesse kaum verändert. Fast immer wurde und wird der finale Entschluss von sehr kleinen Grup...
Warum werden Kriege geführt? Was ist ausschlaggebend für die Entscheidung zum Krieg? Michael Mann erzählt die Geschichte des Krieges vom antiken Rom bis zum Überfall auf die Ukraine, vom kaiserlichen China bis zu Auseinandersetzungen im Nahen Osten, von Japan und Europa bis zur postkolonialen Geschichte Lateinamerikas und zu den Kriegen der Vereinigten Staaten. Obwohl sich die Waffen und die Organisation des Krieges im Laufe der Zeit enorm gewandelt haben, hat sich der Charakter der Entscheidungsprozesse kaum verändert. Fast immer wurde und wird der finale Entschluss von sehr kleinen Gruppen von Machthabern getroffen, manchmal nur von einer Person. Charaktere, Emotionen und Ideologien sind ausschlaggebend. Doch auch Status, Ehre und Ruhm spielen nach wie vor eine große Rolle. Die meisten Herrscher, die Kriege beginnen, verlieren sie, und in historischer Perspektive ist die große Mehrheit der Staaten aufgrund von Kriegen untergegangen. Durch die meisterhafte Verbindung ideologischer, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Analysen eröffnet der preisgekrönte Soziologe Michael Mann neue Perspektiven auf die Geschichte und Gegenwart von Kriegen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.