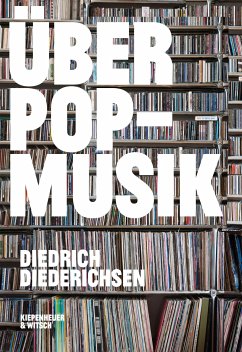Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Was ist Pop, und was macht er mit uns? Diedrich Diederichsen, der klügste und inspirierteste Kritiker, beschreibt das große Ganze
Das Glück, liebe Freunde der elektrischen Ekstasen und der speicherbaren Euphorie, das Vierminutenglück, das uns hoffentlich erfasst, wenn wir die Taste "Play" drücken und unser liebster Popsong in der angemessenen Lautstärke läuft, das Glück, welches die beiden erfolgreichsten Popsongs der vergehenden Saison, "Happy" und "Get Lucky!", schon im Titel versprachen (beziehungsweise: befahlen), dieses Glück kommt natürlich auch zur Sprache in diesem Buch - und zwar genau ein Mal, auf Seite 327, siebte Zeile von unten. Sonst geht es aber weniger ums Glück und auch nicht um die anderen starken Gefühle - es geht in diesem dicken Buch von Diedrich Diederichsen, das "Über Pop-Musik" heißt, noch nicht mal so sehr um die Musik. Es sind viel mehr die Zeichen und die Bedeutungen, es sind die Signifikanten, die den Stil und den Tonfall dieses Buchs bestimmen.
Was natürlich so manchen Leser (und Rezensenten) nervt - die Kälte der Gedanken scheint, auf den ersten Blick jedenfalls, der hohen emotionalen Temperatur des Gegenstands nicht angemessen zu sein. Aber wer die Produktionsbedingungen des Popmusikglücks untersuchen will, darf das Ergebnis nicht schon voraussetzen. Und wer die starken Gefühle nur beschwört und als gegeben hinnimmt, begibt sich immer in die Gefahr, dass er, ohne es zu merken, mit seiner tollen Soundfile ein paar Megabytes an Ideologie gleich mitgeliefert bekommt.
Ohnehin schreibt Diederichsen, der gern Mash-ups aus akademischen Begriffen, dem Fachjargon der Spezialisten und herrlich plastischer Alltagssprache herstellt (noch im allersachlichsten Zusammenhang nennt er Eric Clapton grundsätzlich einen Knallkopf), einen Stil, der manchmal auch die Signifikanten zum Tanzen bringt. Man muss halt auch hier das tun, wovon noch ausführlicher die Rede sein wird: ein bisschen Arbeit investieren, bis man den Rhythmus und vielleicht auch das Glück in dieser Sprache spürt.
Es geht in diesem Buch nicht so sehr darum, herauszufinden, was Pop-Musik eigentlich sei. Es geht darum, wie sie funktioniert. Und dass von der Musik selbst erst einmal wenig zu hören ist, liegt daran, dass Diederichsen semiotische Prozesse untersucht, die, wenn er recht hat, eigentlich immer in Gang kommen - ganz egal, ob leise klagende Mädchen zur akustischen Gitarre sanfte Melodien flüstern oder die Schreihälse der Schwermetallmusik die Verstärker bis zum Anschlag aufdrehen. Es geht also um den Fan mindestens genauso wie um den Musiker, und es geht um die Frage, was außer den Trommelfellen noch in Bewegung gerät, wenn so ein Popsong beginnt.
Die kleinste Einheit der Pop-Musik, sagt Diederichsen, sei nicht der Akkord, der Takt, der einzelne Ton. Die kleinste Einheit sei die Pose - und da verschmelzen schon die Rollen des Musikers und des Fans. Der Impuls, in einer Band zu spielen, komme nicht von besonderer Musikalität, sondern beginne mit dem Blick in den Spiegel, in welchem der künftige Sänger oder Bassist sich in der Popstarpose gefalle. Der Impuls, zum Fan zu werden, komme ganz genau so: Erst wenn auch der Hörer posieren kann, erst wenn er ein ganzes Set von Bildern, Posen, Haltungen mitgeliefert bekommt, ereignet sich das, was Diederichsen Pop-Musik nennt. Damit zur Stimme auch der Körper kam, brauchte die Pop-Musik erst das Kino, dann das Fernsehen, Videoclips, all das, was jetzt zum kostenlosen Gebrauch auf Youtube, zum Beispiel, herumsteht.
Man könnte dem entgegenhalten, dass die Bilder und die Haltungen wichtig, aber nicht unentbehrlich sind: Musik zu hören geht auch ohne sie. Wogegen einem Popstar seine ganzen Posen auch nicht weiterhelfen, wenn er auf einen Hörer trifft, der die entsprechende Musik verabscheut. Aber wenn man sich, je nach Alter, an die entscheidenden Momente der eigenen musikalischen Biographie zu erinnern versucht, dann offenbart sich, dass Diederichsen trotzdem recht hat. Erst war da, nur zum Beispiel, ein Hass auf Hippies und deren Sound, eine Sehnsucht nach Provokation, eine Vorfreude auf einen neuen Look, eine Begeisterung für die modernistischen Plattencover. Und dann legte man Nine Nine Nine auf, hörte nichts als schnellen, grellen Lärm. Und musste sich das Glück hart erarbeiten; es stellte sich frühestens beim fünften oder sechsten konzentrierten Hören ein. Was dann, obwohl dieser Impuls nicht aus der Musik kommt, bei einer Beethoven-Symphonie genauso funktioniert. Erst entscheidet man sich, sie verstehen zu wollen. Und dann erarbeitet man sich das Glück des Hörens.
Wobei Diederichsen dieses Glück nicht leugnen und nicht wegdiskutieren will; es geht ihm aber um etwas, das größer und zugleich kleiner ist. Wenn man es sich leichtmachen wollte, dann könnte man die Dialektik der Pop-Musik, das Schillern zwischen Aufruhr und Totalversöhnung, zwischen Weckruf und Betäubungsdroge, zwischen Konsum und Kritik so auflösen: Die Musik ist die Artikulation eines Schmerzes. Und dessen Linderung für die Dauer eines Songs. Sie ist das Glücksversprechen. Und dessen kurze, heftige Erfüllung. "It's more than we could bear / but you don't really care", sangen Nine Nine Nine in "Emergency", einem Song, der naturgemäß extrem gute Laune brachte.
Diederichsen macht es sich aber nicht leicht. Er führt alle Pop-Musik auf den Jazz und den Blues zurück, auf die musikalischen Artikulationen der enteigneten und entrechteten schwarzen Amerikaner - und das bestimmt seinen Blick noch auf die billigste und trashigste Pop-Musik: Sie braucht, wie Diederichsen sie untersucht, immer ein Gegenüber und am besten: einen Gegner. Pop-Musik ist Behauptung und Selbstermächtigung, Standortbestimmung und Sinnstiftungsmaschine für Teenager in der Erwachsenenwelt, für Schwarze in der von Weißen dominierten Gesellschaft, für Homosexuelle in heterosexuell geprägten Gesamtzusammenhängen.
Wie das einst funktionierte, daran werden sich die Älteren vielleicht noch erinnern: ans Entsetzen altgewordener Progressive-Rock-Hörer, die in den neunziger Jahren die ganze Techno-Bewegung, diese scheinbar bedeutungslosen Maschinenklänge, die Friede-den-Eierkuchen-Parolen der Love Parade und die Selbstunterwerfung freier Menschen unter die Gewalt der Bässe nicht fassen konnten. Und den Jungen empfahlen, gefälligst wieder rebellisch zu sein.
Dieses Gegenüber ist der Pop-Musik aber, genau in dem Zeitraum, in welchem zum Beispiel Diedrich Diederichsen vom 24-Jährigen Chefredakteur der Zeitschrift "Sounds" zum 56-jährigen Professor für Gegenwartskunst wurde, aber immer Pop-Musik-Hörer blieb, leider abhandengekommen. Das Gegenüber ist nicht mehr der Spießer, der alte Sack, der Repräsentant des sogenannten Schweinesystems. Das Gegenüber hört einfach nur andere Pop-Musik und lässt sich auch von radikalem Lärm, akustischer Gewalt oder expliziten Raps nicht erschrecken. Kenne ich schon, sagt dann der 55-jährige Plattensammlungsbesitzer, ich lege gleich mal "Practice Makes Perfect" von Wire auf, damit haben wir in unserer Jugend die Alten erschreckt. Und wenn wir schon dabei sind: Kennt ihr Grünschnäbel Ornette Coleman?
Und so handelt sich Diederichsen, der vom großen Ganzen der Pop-Musik sprechen will, mit seinem Gegenstand das Problem ein, welches der Philosoph Markus Gabriel mit der Welt hat. Es gibt, sagt Gabriel, eigentlich alles, je nachdem, wie man den Gegenstandsbereich definiert, es gibt Staaten, Außerirdische, Algorithmen, Weißwürste und Kunstakademien. Nur die Welt gibt es nicht, weil man sich keinen Gegenstandsbereich vorstellen kann, in welchem man die Welt gegen die Nicht-Welt abgrenzen könnte.
Wenn aber alles Pop-Musik wäre, müsste man sich verabschieden von diesem Begriff - den Diederichsen zu retten versucht, indem er ein Außen konstruiert, welches er Musikmusik nennt. In seinem schönsten Kapitel, einer wunderbar spekulativen und unakademischen Passage, rekonstruiert Diederichsen die Entstehung des Jazz aus dem Artikulationsbedürfnis jener Abkömmlinge der amerikanischen Sklaven, denen man alles genommen hatte, selbst die eigene Sprache und Tradition. Kein Akkord, kein Takt, kein musikalisches Thema gehörte ihnen wirklich. Alles war geliehen, zum schnellen und flüchtigen Gebrauch, jede Improvisation war auch dazu gut, die widerrechtliche Aneignung musikalischen Eigentums zu verschleiern. Diese Praxis, in welcher die notorischen Blue Notes und Synkopen eben nicht Seelenzustände, sondern Besitzverhältnisse reflektieren, verbindet sich mit der neuen Technik, die all das Flüchtige aber elektrisch festhalten und speichern kann - und so entsteht jene ganz andere musikalische Tradition, der Pop, den Diederichsen der guten alten europäischen Musikmusik gegenüberstellt.
Man kann die Geschichte aber auch andersherum betrachten. Man kann sich vorstellen, dass jene musikalische Tradition, die Monteverdi, Mozart und den Wiener Walzer hervorgebracht hat, sich unter dem Einfluss neuer Musiker, neuer Produktionstechniken und eines entsprechend riesig gewordenen Publikums in die Richtung entwickelt, in welcher dann Cole Porter und Charlie Parker, Burt Bacharach und Isaac Hayes, Giorgio Moroder und Jay-Z das weitermachen, was Mozart angefangen hat. Die von Diedrich Diederichsen so genannte Musikmusik, also die Klänge, die man auf seiner liebsten Stockhausen-Platte oder bei den Donaueschinger Musiktagen hören kann, wären in diesem Zusammenhang weniger die Fortsetzung der klassischen Tradition. Vielmehr wären sie die trotzige, elitäre Reaktion auf die Pop-Musik - gewissermaßen der Nicht-Pop als Funktion und Abspaltung einer Pop-Musik, die kein Außen mehr kennen will.
Beethoven oder Schubert stünden dann als Nicht-nicht-Pop genauso zur Verfügung wie die Beatles oder die Supremes, was ja genau die Praxis all jener ist, die sich an fünfzig Jahren Pop ein wenig sattgehört haben. Pop wäre dann gar keine Musik, nur eine zeitgemäße Art der Rezeption.
Das ist das Wunderbare bei Diederichsen. Es ist ein Vergnügen, ihm zu folgen. Und es ist ein Vergnügen, ihm zu widersprechen. We've come too far, to give up who we are. Man muss es lesen: Get lucky!
CLAUDIUS SEIDL
Diedrich Diederichsen: "Über Pop-Musik". Kiepenheuer & Witsch, 474 Seiten, 39,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main