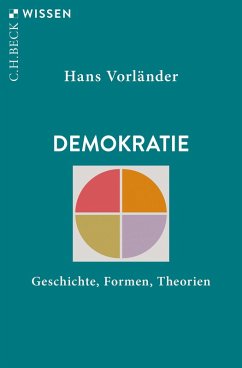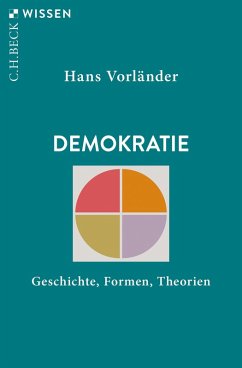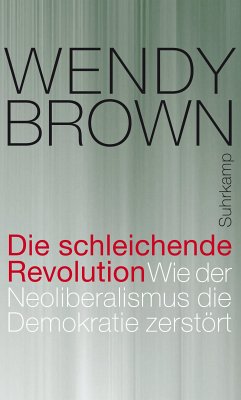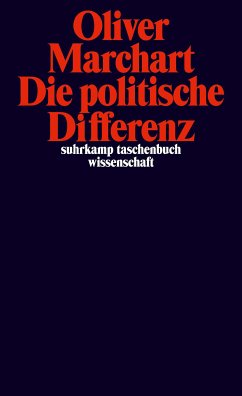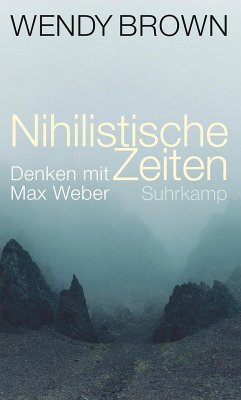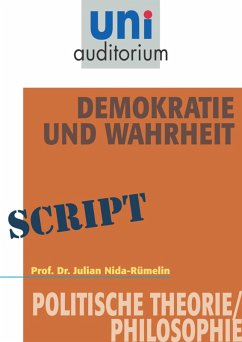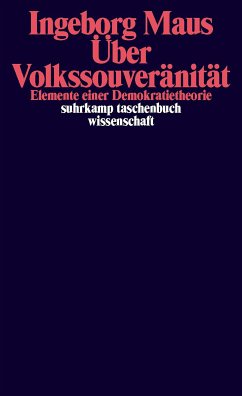
Über Volkssouveränität (eBook, ePUB)
Elemente einer Demokratietheorie
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
21,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das gegenwärtige Wiederaufblühen basisdemokratischer Forderungen verleiht einer Theorie der Volkssouveränität besondere Aktualität. Ingeborg Maus' Konzeption einer »Demokratisierung der Demokratie« verteidigt die gesetz- und verfassunggebende Gewalt des Volkes gegen Staatsapparate, die sich zunehmend aus der Gesetzesbindung befreien und so jeder demokratischen Kontrolle entziehen. Darüber hinaus vertritt sie eine weitgehende Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen an die gesellschaftliche Basis. Das Prinzip der Volkssouveränität wird im Hinblick auf heutige Bedingungen konkretisier...
Das gegenwärtige Wiederaufblühen basisdemokratischer Forderungen verleiht einer Theorie der Volkssouveränität besondere Aktualität. Ingeborg Maus' Konzeption einer »Demokratisierung der Demokratie« verteidigt die gesetz- und verfassunggebende Gewalt des Volkes gegen Staatsapparate, die sich zunehmend aus der Gesetzesbindung befreien und so jeder demokratischen Kontrolle entziehen. Darüber hinaus vertritt sie eine weitgehende Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen an die gesellschaftliche Basis. Das Prinzip der Volkssouveränität wird im Hinblick auf heutige Bedingungen konkretisiert: Eine Analyse der Parzellierung der Gesellschaft und der Fragmentierung des politischen Entscheidungssystems zeigt, daß für eine Realisierung von Volkssouveränität neuer Bedarf und neue Chancen bestehen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.