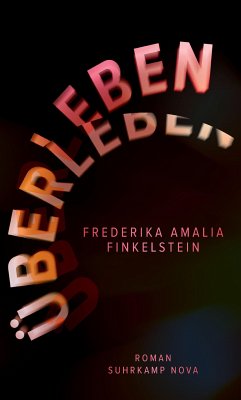Am 13. November 2015 gerät die Welt der dreiundzwanzigjährigen Ava völlig aus den Fugen. Nach dem Anschlag auf den Pariser Konzertsaal Bataclan macht sich eine wuchernde Furcht in Ava breit, und sie kann nicht anders, als sich permanent mit den Bildern des Schreckens zu beschäftigen. Immer wieder betrachtet sie Fotografien der Opfer, lernt Wikipedia-Einträge terroristischer Attentate auswendig und sieht sich Gewaltvideos auf YouTube an. Als sie auch noch ihren Job im Apple-Store verliert, streift sie ziellos durch die Straßen der Stadt. Wie ein Katalysator der Realität absorbiert Ava alles, was sie sieht, um der immer absurder scheinenden Welt einen kleinen Funken Sinnhaftigkeit abzugewinnen.
Frederika Amalia Finkelstein ist die radikale Stimme ihrer Generation. Mit Die Getriebenen hat sie in Frankreich für eine Sensation gesorgt. Nie zuvor hat sich eine junge Autorin der Welt des digitalen Überdrusses, der Einsamkeit und der ständig drohenden Gewalt in einer derart schonungslosen Klarheit gestellt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Frederika Amalia Finkelstein ist die radikale Stimme ihrer Generation. Mit Die Getriebenen hat sie in Frankreich für eine Sensation gesorgt. Nie zuvor hat sich eine junge Autorin der Welt des digitalen Überdrusses, der Einsamkeit und der ständig drohenden Gewalt in einer derart schonungslosen Klarheit gestellt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Eine Begegnung mit Frederika Amalia Finkelstein, die einen Roman über das Bataclan-Attentat in Paris geschrieben hat
Im Herbst 2015 lief für Frederika Amalia Finkelstein alles bestens. Sie war vierundzwanzig Jahre alt, hatte im Jahr zuvor ihren Debütroman bei Gallimard veröffentlicht und damit einen Überraschungshit gelandet: Als "L'Oubli", die Geschichte einer jungen Frau, die, vom Holocaust besessen, ein Recht auf Vergessen wünscht, erschien, da wurde Finkelstein in sämtlichen Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Radio-Shows als "Stimme ihrer Generation" gefeiert. Der Literaturnobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio sprach begeistert von "einem Aufschrei", einer einzigartigen Stimme, auf die das Land gewartet habe. Sein Kollege Frédéric Beigbeder schien ebenfalls betört, und auch wenn einige über ihren nicht so feinen Stil meckerten, war man sich doch insgesamt recht einig darüber, dass man dieser jungen Frau in Zukunft ganz genau zuhören sollte. Weil sie etwas über die Gegenwart sagte, weil sie es auf eine Art und Weise tat, wie es in Frankreich derzeit nur wenige junge Schriftsteller tun. Sie schrieb schon an einem neuen Buch, doch kam der November, und alles wurde anders.
Als am Freitagabend, dem 13. November 2015, um 21 Uhr 25 bewaffnete junge Männer durch das 10. und 11. Arrondissement fuhren und auf unbewaffnete junge Männer und Frauen schossen, da saß Finkelstein, wie so viele andere auch, auf einer Café-Terrasse. Nur saß sie auf der anderen Seite der Seine. Sie hatte gerade eine Freundin getroffen, als ihr Bruder schrieb: "Es hat eine Schießerei gegeben. Mehrere Tote. Geh sofort nach Hause." Den Rest der Nacht verbrachte sie vor dem Fernseher. Sie sah, dass im Bataclan, einem Club, den sie regelmäßig besuchte, gerade eine Geiselnahme stattfand. Sah die Evakuierung, die erst gegen Mitternacht, fast zweieinhalb Stunden nach Beginn des Angriffs, glückte. Sah, wie man mit Planen bedeckte Körper heraustrug, wie Männer und Frauen fassungslos, blutverschmiert, in goldglänzende Decken gewickelt auf dem Bürgersteig standen, sich umarmten, auf ihre Handys starrten, einander suchten. Sie hörte das unaufhörliche Heulen der Sirenen in den Straßen und später die Spezialisten, die im Dauernachrichtensender BFM TV den aussichtslosen Versuch machten, das Unerklärbare irgendwie doch zu erklären. Besonders der Tag danach habe sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, meint sie, als wir uns drei Jahre später an einem grauen Oktobernachmittag treffen: "Die Stadt war ganz leer und still. Wie nach einem Bombardement."
Frederika Amalia Finkelstein sitzt im ersten Stock eines Cafés im 5. Arrondissement von Paris und wirkt etwas angespannt. Wenn sie spricht, schaut sie, zumindest die ersten zehn Minuten, auf den gekachelten Boden, ihr langes braunes Haar nutzt sie wie einen Vorhang, um sich dahinter zu verstecken. Eigentlich lebt die junge Frau zurzeit auch gar nicht in Paris, sondern in Rom. Sie ist dort für ein Jahr Stipendiatin der Villa Medici, ihr Bruder müsse ihr aber etwas Wichtiges mitteilen, deshalb sei sie fürs Wochenende gekommen, sagt sie. Wir treffen uns, um über "Survivre" zu reden, den Roman, den sie drei Wochen nach den Anschlägen zu schreiben begann und der jetzt unter dem Titel "Überleben" auf Deutsch erscheint. Es geht darin, wie der Titel schon andeutet, um das Leben nach der Katastrophe. Darum, wie sich der Blick auf die Welt verändert, wenn im Herzen deiner Stadt hundertdreißig Menschen von jungen Männern in deinem Alter mitten in ihrem banalsten Alltag niedergeschossen werden. Wie sich das Danach für eine Frau ihrer Generation anfühlt. Bisher kamen die meisten Bücher über den 13. November und seine Folgen von Angehörigen oder Überlebenden. Wie war es für sie, über dieses Ereignis und das, was folgte, aus ihrer Sicht zu schreiben? "Das Buch war hier ein ziemlicher Reinfall", sagt sie unumwunden, ganz cool. Sie zieht sich ihre schwarze LA-Dodgers-Cap vom Kopf, legt sie auf den Tisch über ihr Handy, schaut sich verstohlen um. "Voll hier, oder?"
Eigentlich hatten wir das "Le Sorbon" ausgewählt, weil es hier immer still und leer ist, an diesem Nachmittag sind allerdings alle Plätze belegt. Familien scharen sich um heiße Schokoladen mit Sahne, zwei Amerikanerinnen reden über ihre neu entdeckte Frenchness, die Leute quatschen und lachen laut. Zwei Tage zuvor ist ein bewaffneter Mann in Pittsburgh in eine Synagoge eingedrungen und hat elf Menschen erschossen, in Brasilien wurde der Rechtsextreme Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt, gerade hat sich eine Frau im Zentrum von Tunis in die Luft gesprengt. Ob die Leute um uns herum wohl darüber reden? "Sicher nicht", meint Finkelstein. Es seien doch Herbstferien. Was man jetzt will, ist: Normalität, Frieden, solche Dinge. Konzepte, an denen die 27-Jährige mit ihrem kurzen, atemlosen Roman ziemlich heftig rüttelt. Denn ihre Protagonistin, die 25-jährige Ava, bekommt das mit dem Überleben, dem Vergessen oder, wie sie es nennt: dem "über die Toten hinweggehen" einfach nicht so gut hin. Statt wie alle anderen über anderes zu plaudern, bis sich der Kloß im Bauch endlich gelöst hat; statt wie ihr Kollege an einen neuen Tesla zu denken und sich dem immer gut ablenkenden Konsum hinzugeben, beschäftigt sich die junge Frau obsessiv mit Massenmorden und Toten: Sie kann die Namen der Opfer sämtlicher Anschläge und Amokläufe der letzten Jahre aus dem Stegreif aufzählen, die von "Le Monde" veröffentlichten Porträts der Opfer des 13. November hängen an ihrer Schlafzimmerwand.
Klingt makaber? Ist es auch. Oder eben auch gar nicht. Denn im Grunde beschäftigt sich Ava ja nur mit dem, was ihr Handy- und Fernsehbildschirme ohnehin permanent entgegenspucken: Tote in Syrien. Tote im Mittelmeer. Tote vor der Haustür. Tote überall. Umso mehr Tote, umso höher die Einschaltquote, das weiß jeder, nur weiß sich eigentlich auch jeder zu schützen. Ava weiß das seit dem 13. November nicht mehr, ihr ist der Glaube, die Illusion, das Vertrauen, wie auch immer man es nennen mag, abhandengekommen, und so zieht sie sich jedes noch so grässliche Bild des Anschlags aus dem Netz, fast so, als hoffe sie, darin eine Form von Wahrheit zu finden. Als könne die permanente Konfrontation mit Details aus dem diffusen Grauen etwas Greif- und somit Verdaubares machen. Und weil der Leser ihrem inneren Monolog folgt, wird auch für ihn alles ausformuliert: Der zu Konfetti zerfetzte Körper eines Mannes, der sich in die Luft gesprengt hat; das Stück Gehirn, dass da plötzlich an einer Schuhkappe klebt, vor allem aber das "Massengrab im Bataclan", ein Bild, das Finkelstein geprägt hat. Man sieht dort etwa achtundzwanzig Körper am Boden liegen. Übereinander, nebeneinander, verrenkt. Das Parkett um sie herum ist blutrot, die Schlieren lassen vermuten, dass ein Großteil der Leichen bereits rausgezogen wurden.
Damals habe man versucht, dieses Foto zu zensieren, erinnert sie sich, nur will man in Social-Media-Zeiten ja alles sehen. Auch das Schlimmste. Innerhalb weniger Stunden war es überall: "Es ist schrecklich, das zuzugeben, aber in solchen Bildern liegt auch eine gewisse Faszination." Ava spricht von einem "blutgetränkten Fleisch- und Klamottenberg". Muss man das so krass beschreiben? "Ich finde schon. Literatur muss umhauen, es muss ein Schock sein", sagt sie und nennt Faulkner als Vorbild. Andere fanden das einfach nur geschmacklos: "Eine meiner einzigen Lesungen in einer Buchhandlung wurde abgesagt, weil die Gemeinschaft der Angehörigen der Opfer des 13. November einen Brief schrieb, in dem sie meinten, mein Buch sei eine Schande." Kann sie das verstehen? Ja und nein. Natürlich habe sie sich auch gefragt, ob es okay sei, darüber zu schreiben, darüber so zu schreiben, wo sie ja "nur" vor ihrem Fernseher saß. Nur hätte diese Nacht und ihre Bilder, die Tage, Wochen, Monate danach, ja alle betroffen und traumatisiert. Ganz besonders Menschen ihrer Generation: "Für mich war das unser 11. September. Ein Bruch. Die Folgen davon werden wir, glaube ich, erst viel später wahrnehmen."
Welche Folgen es ganz unmittelbar für sie, für Ava, für viele Menschen in ihrem Alter, für viele Pariser hatte, beschreibt sie extrem gut: Die permanente Paranoia, die diffuse Angst in der Metro, am Bahnhof, im Kaufhaus, an überhaupt allen prominenten Plätzen. Die leichte Panik, die ausbrechen konnte, wenn man kurz mal vergaß, zu vergessen, und die Bilder wieder hochkamen: "Es verging kein Tag, an dem ich mir nicht das Schlimmste ausmalte", sagt Ava und spricht damit nicht nur für sich selbst. Es sei eigentlich absurd, meint Finkelstein, als Kind habe sie die brutalsten Videospiele gespielt, aber ihr sei erst durch den 13. November klar geworden, wie sehr unsere Normalität nicht der Frieden, sondern die Gewalt ist, wie sehr sie alles einnimmt. "Das wirklich Irrationale und tatsächlich Unerklärbare ist nicht das Böse, im Gegenteil: es ist das Gute", schrieb Kertész, seit dieser Nacht verstehe sie den Satz besser. Die Illusion der Sicherheit als Normalzustand ist abhandengekommen. Trotzdem hört man in "Überleben" die Großeltern von Ava sagen, sie solle sich freuen, dass sie keinen Krieg erleben musste.
Liegt darin für sie ein Missverständnis? "Irgendwie schon, ja. Was wir erleben, ist eine andere Form des Krieges, eine perversere, weil es ein Krieg ist, der seinen Namen nicht nennt, der keine Konturen hat, sondern immer und überall über einen hereinbrechen kann. Das kann einen wahnsinnig machen." Wenn man den Zweifel, den die Toten säen, zulässt, dann ist man verloren, sagt Ava, dann geht man daran zugrunde. Finkelstein, die jetzt gar nicht mehr zu Boden schaut, ist daran zum Glück nicht zugrunde gegangen. "Ich habe beschlossen, mit diesen Themen abzuschließen. Ich will ein neues Kapitel beginnen", meint sie und wirkt wie jemand, der sich ganz fest etwas vorgenommen hat. In ihrem nächsten Buch soll es um die Schönheit gehen, um Cy Twombly unter anderem. Vor ein paar Wochen habe sie Gaeta besucht, das süditalienische Hafenstädtchen, in dem Twombly seinen Lebensabend verbrachte. Schön habe sie es dort gefunden. Sehr friedlich.
ANNABELLE HIRSCH
Frederika Amalia Finkelstein: "Überleben". Aus dem Französischen von Sabine Erbrich, Suhrkamp-Verlag, 146 Seiten, 14 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Schon auf den ersten 30 Seiten trifft einen Überleben, Frederika Amalia Finkelsteins zweiter Roman, wie ein Leberhaken. ... Überleben funktioniert gerade deshalb so gut, weil es keine fadenscheinigen Erklärungen anbietet. Stattdessen spiegelt das Buch in seiner fiebrigen Sprache die individuellen Auswirkungen einer überhitzten Realität.« Dennis Pohl SPIEGEL ONLINE 20180924